
Anfangstakte von Thelonious Monks Komposition Trinkle Tinkle
(Transkription des Autors, nur rechte Klavierhand)
Radio / Videos
Verzeichnis aller Artikel
Microstructures of Feel, Macrostructures of Sound:
Embodied Cognition in West African and African-American Musics
(Mikrostrukturen des Gefühls, Makrostrukturen des Sounds:
Verkörperte Wahrnehmung in west-afrikanischen und afro-amerikanischen Musikformen, 1998)1)
Inhalt:
1. Einführung
2. Begriffsbestimmungen
3. Neue Paradigmen: der verkörperte Geist, die situierte Wahrnehmung
4. Musikwahrnehmung und Embodiment
5. Zur Wahrnehmung des Metrums
6. Mikrotiming-Studien
7. Beschreibung rhythmischen Verhaltens, Darstellung rhythmischer Strukturen
8. Schlussfolgerungen für die Musikwahrnehmung, die Musikwissenschaft und die Computermusik
[...]
[...]
Kognitionswissenschaft
[...]
Kognition
[...] Dieser Begriff dient als Rahmen für eine große Vielfalt an Aktivitäten und mentalen Prozessen. Er wird gelegentlich von der Wahrnehmung unterschieden, um die Abstraktionen der „höheren“ Ebene zu bezeichnen. Der Begriff unterstellt auch, dass diese Prozesse wissenschaftlich beschrieben werden können, das heißt die Verwendung des Begriffes „Kognition“ bezieht sich auf das Fach der Kognitionswissenschaften.
Wahrnehmung
[...]
Kognitives Modell
[...]
Repräsentation
[...]
Musik
[...]
Gruppierung
[...]
Rhythmus
[...]
Puls
Letztlich bezeichnet Puls jede Periodizität, die einem Rhythmus oder einer Kombination von Rhythmen innewohnt oder in ihnen wahrgenommen wird. Puls bedeutet vor allem auch Isochronismus [das heißt ein feststehendes Tempo], oft in gewissem Maß ein „Hervortreten“ in der Wahrnehmung und schließlich auch einen Frequenzbereich zwischen 1,2 und 3,3 Herz (eine unscharfe Kategorie, die als Tactus-Bereich, als Bereich des menschlichen Herzschlags, der menschlichen Fortbewegung und des Saugreflexes eines Säuglings bekannt ist). Aus einer wissenschaftlichen Perspektive kann bei einer Definition auf diese Bedeutungen gänzlich verzichtet werden; sie scheinen aus der engeren Bedeutung durch sprachlichen und kulturellen Gebrauch des eigentlichen Begriffes abgeleitet worden zu sein. Der Beat entspricht annähernd dem Puls, abgesehen davon, dass er variabler ist; in manchen Zusammenhängen wird er sehr im Sinne des Tactus-Bereichs verstanden, in anderen Zusammenhängen wird der Begriff auf jeden Zeitmaßbereich bezogen verwendet. Beats können auch als abstrakte Quantität dienen, sodass Noten einen Bruchteil eines Beats andauern. Einige Autoren (Lerdahl & Jackendoff 1983) haben darauf bestanden, dass Beats mehr als Punkte und weniger als Zeitintervalle zu betrachten sind. Der allgemeine Gebrauch legt jedoch andere mögliche Bedeutungen nahe. Beats können also beides bedeuten: den einzelnen Zeitpunkt, in dem das Intervall eintritt (im Sinne von „beginne die Note auf dem Beat“), und das laufende Intervall zwischen solchen Zeitpunkten (im Sinne von „halte diese Note über 3 ½ Beats“).
Tactus
Der Tactus wird seit langem als mäßig schneller Puls verstanden, wie er in der meisten rhythmischen Musik zu finden ist. Wenn Hörer gebeten werden, mit einem Finger oder Fuß zur Musik zu klopfen, wählen sie üblicherweise regelmäßige Zeitintervalle im Bereich von 300 bis 800 Millisekunden, also durchschnittlich ein etwas langsameres Tempo als 2 Beats pro Sekunde (Fraisse 1982). Wenn die Musik schneller wird, neigen Hörer dazu, stufenweise langsamere Pulse zu finden, sodass sie wiederum in diesen Frequenzbereich passen und so weiter. Der Bereich des Tactus ist auch der Bereich des „spontanen“ Tempos, das heißt des Tempos, das üblicherweise von einer Person gewählt wird, wenn sie gebeten wird, einen ständigen Puls zu klopfen. Dieser Bereich deckt sich mit einem moderaten Schritttempo beim Gehen, dem menschlichen Herzschlag, der Frequenz von Kieferbewegungen beim Kauen und des Saugreflexes eines Säuglings. Somit scheint der Tactus mit den natürlichen Zeitskalen, die mit menschlicher Bewegung auftreten, zu korrespondieren; wir müssen uns ein Backenhörnchen vorstellen, um einen schnelleren Tactus zu haben.
Polyrhythmus
[...]
Metrum
Im weitesten Sinne ist das Metrum eine periodische Gruppierung einer musikalischen Zeiteinheit. In der europäischen Konzertmusik bedeutet das Metrum traditionellerweise eine Hierarchie aus schwachen und starken Beats. Wie ich in Kapitel 5 darlege, kann das Metrum jedoch ohne solche Hierarchie bestehen. Das Metrum bezeichnet eine Sub-Harmonie (oder Gruppierung) eines Pulses und kann auch eine höhere Harmonie (oder Unterteilung) desselben Pulses bedeuten. Das heißt, das Metrum kann Pulse in regelmäßige Einheiten zugleich gruppieren und unterteilen. Zum Beispiel bedeutet die Zeitangabe 6/8 einen Zyklus von 2 Pulsen, die beide in 3 gleiche Untereinheiten geteilt sind. Man beachte, dass das Metrum als eine periodische Gruppierung von Pulsen betrachtet wird – das heißt als ein Phänomen der Kognition/Wahrnehmung, nicht als eine objektive Realität des akustischen Signals. Diese Unterscheidung wird jedoch oft ignoriert, so sprechen wir oft vom Metrum eines Musikstückes (mehr zu diesem Thema: siehe Kapitel 5).
Expressives Timing
[...]
Mikrotiming
[...]
Groove
Ich glaube, dass die afrikanischen und afro-amerikanischen Tanzmusikarten und die von ihnen abgeleiteten Genres im Sinne eines „Grooves“ verstanden werden sollen – wobei „Groove“ beschrieben (aber nicht definiert) werden kann als ein gleichförmiger Puls, der gemeinschaftlich durch eine ineinander verzahnte Zusammensetzung von rhythmischen Gebilden errichtet wird. Ein Groove tendiert dazu, einen hohen Grad von Regelmäßigkeit aufzuweisen, vermittelt aber auch ein Gefühl der Lebendigkeit. Groove schließt eine Betonung des Prozesses des Musikmachens mit ein, weniger eine Betonung der Syntax (Keil & Feld 1994). Der Schwerpunkt liegt weniger auf dem logischen Zusammenhang und den Noten selbst, sondern mehr auf der Spontaneität und wie diese Noten gespielt werden. Groove betrifft die Belebung und Ausschmückung der Zeit, wie sie von den Musikern und dem Publikum gemeinsam erlebt wird. Das entspricht der funktionellen Rolle afrikanischer und afro-amerikanischer Musikarten in deren Gemeinschaften. Sowohl die afrikanischen als auch die afro-amerikanischen Völker zeigen eine kulturelle Tendenz, Musik von einer funktionalen Grundlage her zu verstehen. Das heißt Musik wird nicht bloß als Werk der Kunst zum Selbstzweck der Kunst verstanden, sondern als eine Aktivität, die in das Leben integriert ist und zum Teil die Realität des Alltages strukturiert.
Eine hervorstechende Eigenschaft von Musikarten, die auf Groove beruhen, scheint eine Aufmerksamkeit auf eine zusätzliche, verbindende Ebene unterhalb der Ebene des Tactus zu sein, zum Beispiel: Wenn die Viertelnote der Tactus ist, so kann man sich auch auf die Sechzehntelnote konzentrieren, um die rhythmische Präzision zu erhöhen. Es ist experimentell belegt, dass das Gespür für lange zeitliche Intervalle unbeständiger ist als für kurze (Webersches Gesetz) [...] Deshalb erreichen wir tatsächlich Genauigkeit im Timing eines moderaten Pulses, indem wir ihn unterteilen. Nach Fraisse (1982) teilen Musikhörer rhythmische Intervalle typischerweise in zwei Kategorien, lang und kurz. Diese Intervalle stehen gewöhnlich im Verhältnis von 2:1, was darauf hinweist, dass das kleinere Intervall eine Unterteilung des größeren ist; das lange Intervall liegt gewöhnlich im Tactus-Bereich, während das kurze im Sub-Tactus-Bereich liegt. Fraisse bemerkt, dass diese zwei Kategorien unterschiedliche Auswirkungen in der Wahrnehmung haben. Während der langen Intervalle können wir den Verlauf der Zeit wahrnehmen, während wir in einem kurzen Intervall kein zeitliches Ausmaß empfinden. Wir können jedoch eine qualitative Wahrnehmung von der Gruppierung einer Reihe solcher kurzer Intervalle haben (Fraisse 1956, zitiert in Clarke 1999), etwa in der Form ihrer „Zwei-heit oder Drei-heit oder Akzentuiertheit oder Unakzentuiertheit“ (Brower 1993: 25). Aus diesem und aus anderen Gründen ist die kleinste funktionsfähige musikalische Unterteilung des Tactus als ein „zeitliches Atom“ bezeichnet worden, das von Bilmes (1993) abgekürzt „Tatum“ genannt wurde, in Huldigung des Meisterpianisten Art Tatum (CD-1).
Zu Groove gibt es nichts Entsprechendes in der europäischen Konzertmusik und deshalb ist er mit den von der Konzertmusik hervorgebrachten Modellen nicht beschreibbar. Auf Groove beruhende Musikarten weisen nicht die Phrasen-Ende-Verlängerungen Ritardandi, Accelerandi, Rubati oder andere expressive Tempo-Modulationen der klassischen europäischen Musik auf; vielmehr enthalten sie winzige, subtile Mikrotiming-Abweichungen von der strengen Regelmäßigkeit, während der Puls insgesamt isochron [gleichförmig] gehalten wird. Diese Art des rhythmischen Ausdrucks hat eine gesamte, eigene, stillschweigende Grammatik mit einer eigenen Ästhetik, eigenen Techniken und Methoden des Ablaufs. Während sich viele Bemühungen der Forschung auf die Erforschung der zuvor erwähnten Tempo-Modulationen [Ritardandi und so weiter] konzentriert haben (zum Beispiel Longuet-Higgins 1982, Todd 1989, Repp 1990), wurde für das expressive Timing im Kontext eines gleichförmigen Pulses oder Grooves sehr wenig Interesse aufgebracht. Manchmal wurden sie als „kleine Beschleunigungen und Verzögerungen“ beschrieben (Magill & Pressing 1997), das heißt im Sinn eines größeren Konstruktes, das als Tempo bezeichnet wird, als würde die Existenz einer Art musikalischen Zeit unterstellt werden, die von den musikalischen Ereignissen, die sie bilden, unabhängig ist.
Bilmes (1993) hat ein Modell für Groove-basiertes expressives Timing entwickelt, das zwei gleichzeitige, gleichförmige Pulse enthält: einen auf der Ebene des Tactus eines Fußklopfens (üblicherweise mit einer Periode von 300 bis 800 Millisekunden) und einen anderen Puls, der das zeitliche Atom oder Tatum bildet, also die kleinste funktionsfähige Unterteilung des ersten Pulses (üblicherweise 80 bis 150 Millisekunden). Der Zeitpunkt des Einsatzes einer Note, die in einem bestimmten Tatum eintritt (das heißt eine bestimmte Sechzehntelnote, Vierundzwangzigstelnote oder andere derartige Noten), kann durch eine laufende Abweichung von der perfekten Quantisierung2) abgewandelt werden. So kann der rhythmische Ausdruck auf der Ebene des Tatum auftreten, ohne den gesamten Tactus oder das Tempo zu beeinträchtigen. Diese Darstellung wird in Kapitel 7 beschrieben und weiter ausgeführt.
Aufmerksamkeit
[...]
3. Neue Paradigmen: der verkörperte Geist, die situierte Wahrnehmung
Musik stellt ein besonders interessantes Laboratorium für das Studium der Kognition dar. Weil so viel an musikalischem Verhalten in seinem Wesen nicht-sprachlich ist, tendiert die Musik dazu, die herrschenden linguistischen Paradigmen herauszufordern, die alle Kognition auf rationale Denkprozesse, wie Problemlösung, logische Schlussfolgerung und Rückschluss, reduzieren. Leider hat sich die meiste Forschung über die Musikwahrnehmung und Musikerfassung auf eine sehr schmale Bandbreite des menschlichen Musikphänomens konzentriert, nämlich auf die tonale Konzertmusik des westlichen Europas vor dem 20. Jahrhundert, wie sie durch die gegenwärtigen, aus Europa stammenden Aufführungspraktiken gefiltert wird. Deshalb haben wir eine Menge an Modellen und Darstellungen des Phänomens der Musikwahrnehmung und Erfassung, die von tonaler Musik inspiriert sind und die sich fast zur Gänze auf die Organisation der Tonstufen im Bereich der groß-skaligen Zeit konzentrieren. Einige Beispiele dafür sind Theorien über rekursive formale Hierarchien (Lerdahl & Jackendoff 1983) und über die musikalische Bedeutung von aufgeschobenen melodischen oder harmonischen Erwartungen (Narmour 1990, Meyer 1956). Lerdahl and Jackendoff (1983) behaupten, dass durch die Art, wie die Stufen der Informationsprozesse organisiert sind, das musikalische Erfassen völlig der sprachlichen Kognition entspricht. Solche Modelle nehmen an, dass die Erfassung von Musik aus der logischen Syntaxanalyse von rekursiven Baumstrukturen bestehen, um immer höhere Ebenen der hierarchischen Organisation aufzudecken.
[...]
Gewiss mögen einige musikalische Merkmale gemeinsame Elemente mit der Sprache haben. [...] Ein großer Teil des musikalischen Verstehens scheint jedoch insgesamt ziemlich getrennt vom Bereich der rationalen Sprache und dem logischen Schlussfolgern abzulaufen.
Obwohl die Ergebnisse von Lerdahl und Jackendoff (1983) oft als musikalische Allgemeingültigkeiten hingestellt werden, sind sie nicht übertragbar auf die große Mehrheit von nicht-westlichen Musikformen und sie erklären auch nicht gänzlich die Wahrnehmung und Erfassung von westlicher tonaler oder atonaler Musik. Die Unanwendbarkeit dieser aus der Sprachwissenschaft abgeleiteten Modelle auf andere Musikarten wird in den Fällen der west-afrikanischen und afro-amerikanischen Musikformen, wie Jazz, Rumba, Funk und Hip-Hop, besonders deutlich. In diesen Fällen scheinen gewisse hervorstechende musikalische Eigenschaften, besonders das Konzept des Grooves, keine Entsprechung in der rationalen Sprache zu haben. Wenn Groove auch eine hochgradig subjektive Qualität ist, so kann Musik, die groovt, doch das Interesse oder die Aufmerksamkeit eines mit dieser Kultur vertrauten Hörers über lange Strecken aufrecht erhalten, selbst dann, wenn auf der musikalischen Oberfläche „nichts passiert“. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist die Musik von James Brown (CD-2), die häufig ziemlich wenig melodisches oder harmonisches Material aufweist und hochgradig repetitiv [sich wiederholend] ist, aber dennoch nie als statisch beschrieben werden würde. Die Tatsache, dass Groove genug Gewicht hat, um in einer gewissen Art des musikalischen Erlebens andere musikalische Faktoren zurücktreten zu lassen, zeigt, dass der traditionelle, auf den Sprachwissenschaften gegründete Standpunkt für die Beschreibung der Gesamtheit der Musikerfassung unzureichend ist.
Ein Hauptgrund für dieses Missverhältnis zwischen der Grammatik der tonalen Musik und der meisten Musik der Welt besteht nicht (wie üblicherweise angenommen) in unterschiedlichen Graden der musikalischen Verfeinerung und Komplexität, sondern mehr in einem wesentlichen kulturellen Unterschied im Zugang zu rhythmischer Organisation und musikalischer Form. Ich behaupte, dass eine essentielle Komponente dieses Unterschiedes in der Bedeutung liegt, die der Körper und die Körperbewegung im Akt des Musikmachens hat. Die Rolle des Körpers in den verschiedenen Musikarten der Welt wird klarer, wenn man die Funktionen betrachtet, die Musik und Tanz in der jeweiligen Kultur haben [...]. Diese Betrachtungen haben uns dazu geführt, die Rolle des Körpers in der Kognition im Allgemeinen zu untersuchen.
Kognitivismus & traditionelle Kognitionswissenschaft
[...]
Verkörperte Kognition
Die neuesten konzeptuellen Entwicklungen in der Kognitionswissenschaft gehen in die Richtung einer Einbeziehung solcher Dimensionen. Die Kognitionswissenschaftler haben insbesondere begonnen, Verbindungen zwischen den Strukturen der mentalen Prozesse und der physischen Verkörperung [Embodiment] herzustellen. Der Blickwinkel, der als verkörperte[embodied] oder situierte [situated] Kognition bezeichnet wird, versteht die Kognition als eine Aktivität, die durch den Körper und ihre Situiertheit im Umfeld strukturiert wird – also als verkörperte Aktion. Aus dieser Sicht hängt die Kognition von den Erfahrungen ab, die auf dem Besitz eines Körpers mit sensomotorischen Kapazitäten beruhen; diese Kapazitäten sind situiert in einen umgebenden biologischen, psychologischen und kulturellen Kontext. Sensorische Prozesse (Wahrnehmung) und motorische Prozesse (Bewegung) haben sich miteinander entwickelt und werden deshalb als grundsätzlich untrennbar voneinander und als einander informierend betrachtet; sie sind so gestaltet, dass sie unsere begrifflichen Systeme erden. (Varela u.a. 1991: 173)
[...]
Situierte Kognition
Die vorangegangene Beschreibung des mit dem Körper verbundenen Geistes deckt nur die Hälfte des Bildes ab. Wenn wir einräumen, dass die Kognition zumindest zu einem gewissen Grad durch körperliche Erfahrung strukturiert wird, dann müssen wir den Körper als in einem Umfeld situiert verstehen, das seine Erfahrung prägt. Deshalb verlangt die Philosophie des Embodiments [der Verkörperung] auch eine zeitliche, physische und sozio-kulturelle Situiertheit.
[...]
4. Musikwahrnehmung und Embodiment
[...]
Aus Studien über hirngeschädigte Patienten ergab sich Folgendes: Man braucht offenbar die Steuerung der Körperbewegungen (vor allem die Planung der Bewegungen), um die rhythmische Komponente einer Musik überhaupt wahrnehmen zu können. Aus der sensomotorischen Perspektive ist ein wahrgenommener Beat buchstäblich eine vorgestellte Körperbewegung. Der Akt des Musikhörens benutzt die selben mentalen Prozesse, die die Körperbewegung erzeugen.
Es finden sich in der Musik die Frequenzen von Körperbewegungen wieder, zum Beispiel:
1) Atmen, moderate Armbewegung, Körperschaukeln
- „Phrase“, 1 Herz
2) Herzschlag, Saugen/Kauen, Fortbewegung, Geschlechtsverkehr,
Kopfschütteln
- „Tactus“, 1-3 Herz
3) Sprechen/Zungenbewegung, Handgesten, Fingerbewegung
- „Tatum“, 3-10 Herz
Die Längen der Phrasen von Blasinstrumenten sind natürlich von der Lungenkapazität abhängig. Tactus-betonte urbane Tanzmusik bezieht sich musikalisch oft auf Fußstampfen und auf sexuelle Andeutungen. Von Blues-Gitarristen, Jazz-Pianisten und Quinto-Spielern in der afro-kubanischen Rumba-Musik wird oft gesagt, dass sie mit ihren Händen und Fingern „sprechen“. Diese Beispiele zeigen die körperliche Seite der Musik bei ihrer Erzeugung und auch bei ihrer Wahrnehmung durch Hörer.
[...]
Zeit und Timing
[...] In einem auf Groove beruhenden Kontext kommt der rhythmische Ausdruck auf der Ebene eines extrem feinen Zeitmaßstabes zustande – so schnell, dass ein einfacher auditorischer Feedback-Mechanismus für seine Realisierung ausgeschlossen wird (Fraisse 1982). Das betrifft eine alte Frage in der Neurowissenschaft, die als das Problem der seriellen Ordnung im Verhalten bekannt ist (Lashley 1951). Die Frage ist, wie kann man unsere Erfassung und Produktion von sehr schnellen Sequenzen von Ereignissen in der Zeit erklären, wenn die menschlichen Reflexe und neuronalen Übertragungsgeschwindigkeiten dafür zu langsam erscheinen. Lashley führt die allgemeine Erfahrung von Fehlern in der seriellen Anordnung schneller Sequenzen, wie etwa beim Maschinschreiben, als Beweis für eine hierarchische Organisation in dieser Art des Verhaltens an.
Es ist evident, dass das zeitliche, rhythmische und gruppierende Erfassen und Produzieren bei Zeiten unter ungefähr einer halben Sekunde andere Formen der Verarbeitung verwendet als für längere Zeiten (Fraisse 1956: 29-30, zitiert in Clarke 1999; auch Preusser 1972, Michon 1975). Diese Kurzzeitprozesse werden verschiedentlich als „prä-kognitiv“, „sensorisch“ oder „unmittelbar“ beschrieben – also mehr als eine Art von Sinneseindruck, Erkennung oder Gestaltwahrnehmung und weniger als Form eines analytischen oder zählenden Prozesses. Es wurde behauptet, dass diese Trennung mit dem Wechsel zwischen dem so genannten Echogedächtnis und dem Kurzzeitgedächtnis korrespondiert, wie von den verwendeten Zeitmaßstäben und anderen Experimenten angedeutet wird (Michon 1975, Brower 1993).
Infolgedessen müssten diese unterschiedlichen Regime des Gedächtnisses musikalische Rhythmen über und unter dieser ungefähren Trennlinie in zwei qualitativ unterschiedliche Phänomene teilen. Für pulsbasierte Musik bedeutet das, dass diese Trennlinie im Tactus-Bereich (300 bis 800 Millisekunden) liegt; darunter liegendes rhythmisches Material wird grundsätzlich als Kombinationen von Unterteilungen des bestimmenden Hauptpulses wahrgenommen; darüber liegende Zeitspannen werden auf der Ebene der metrischen Gruppierung von Pulsen wahrgenommen. Wie ich im nächsten Kapitel diskutieren werde, ergibt diese Unterscheidung Folgendes: Das Echogedächtnis deckt die unmittelbare Zeitskala der rhythmischen Aktivität ab, während das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis das Metrum und die Phrasen abdeckt. Diese unterschiedlichen Typen des Gedächtnisses bringen unterschiedliche Arten der Verarbeitung mit sich. Wir kuppeln ein in einen Puls, der auf der Echo-Erinnerung des vorhergehenden Pulses beruht und auf einer gewissen passenden inneren Oszillator-Periodizität; wir fühlen die Beziehung zwischen starken und schwachen Beats (Akzent-Metrum); wir zählen Zeiten zwischen Phrasen oder Takten (metrische Gruppierung); und wir erkennen Sub-Puls-Rhythmen qualitativ (Brower 1993). Eine den Körper einbeziehende Beschreibung der Wahrnehmung und Erfassung von Rhythmen verlangt die Berücksichtigung dieser inhärenten Unterschiede im menschlichen Gedächtnis.
Die Rolle unterschiedlicher Arten des Gedächtnisses weist auf die Notwendigkeit eines eigenen Modells zur Erklärung der rhythmischen Verarbeitung im Bereich eines sehr feinen Zeitmaßstabs. Ein Hinweis kommt von der Echo-Lokalisation von Fledermäusen und Eulen, bei der eine neuronale Bauweise von Verzögerungslinien dazu dient, dem Lebewesen ein wesentlich höheres zeitliches Auflösungsvermögen zu verschaffen, als die neuronale Übertragung es anscheinend erlaubt (Feldman 1997). Man kann sagen, dass die zeitliche Gehörschärfe des Tieres „in“ diesen langen neuronalen Leitungen liegt – in der physischen Struktur des Wahrnehmungsapparates. Eine Arbeitshypothese, die von der Existenz solcher Strukturen inspiriert ist, besagt, dass präzise getimte rhythmische Aktivitäten den gesamten Körper in einer komplexen, ganzheitlichen Weise einbeziehen, wobei sie auditive, visuelle und sensomotorische Kanäle kombinieren.
Der Embodiment-Hypothese entsprechend entstehen kognitive Strukturen aus verstärkter intermodaler sensomotorischer Koppelung. Aus dieser Sicht kann die Wahrnehmung von Kurzzeitrhythmen physische Sinnesempfindung, visuelle Einkuppelung und klangliche Verstärkung einschließen, unbeeinflusst von einer symbolischen Repräsentanz. Bei Musikern (besonders bei polyphonen, Multi-Gliedmaßen-Instrumenten wie Trommeln oder Klavier) bezieht die Kognition den physischen Akt des Musikmachens als eine elementare Ingredienz ein. Man beachte die Komponenten der sensorisch-motorischen Bilder, die mit der Rhythmus-Wahrnehmung (gegründet im Echogedächtnis) assoziiert werden: eine Komponente des Phrasen/Körperschaukel-Oszillators (im Atmen gegründet), eine Komponente des Tactus/Fußklopf-Oszillators (in Fortbewegung gegründet) (Todd 1994) und eine Komponente des Tatum/Mehrere-Fingerklopf-Oszillators (im Sprechen und in der Fingerbewegung gegründet). [...]
Kinästhetik
Begriffe wie Kinästhetik, haptisch oder propriozeptiv beziehen sich auf die Psychologie des körperlichen Feedbacks. Sie beziehen sich alle auf die Empfindung der körperlichen Position, Präsenz oder Bewegung, die sich aus der taktilen Empfindung und dem vestibulären Input ergeben. Wir verlassen uns auf diese Wahrnehmung, wann immer wir irgendeine physische Aktivität betreiben; sie hilft uns, Objekte in der Hand zu halten, aufrecht zu gehen, sich an eine Wand zu lehnen, Essen in unseren Mund zu führen und zu schlucken. In diesen Fällen gibt es eine starke Interaktion zwischen Kinästhetik und visuellem Input. Auf ähnliche Weise müssen wir beim Spielen von Musikinstrumenten mit den akustischen und kinästhetischen Dimensionen als interaktive Parameter umgehen; wir müssen das raum-motorische [spatiomotorische] Verfahren der musikalischen Performance beachten.
[...]
Blacking (1973) warf das Thema der Kinästhetik in musikalischer Performance auf, indem er zwei Typen von Kalimba-(„Daumen-Klavier“)-Musik in der Venda-Community von Süd-Afrika verglich. Ein sehr physischer Typ, der von Amateur-Burschen praktiziert wird, wies komplexe Melodien auf, die als sekundäre Produkte von strukturierten Daumenbewegungen erscheinen; die Regelmäßigkeit der Bewegungen erzeugte das gezackte melodische Ergebnis. Der andere Typ, ein populärerer Stil, der von professionellen Musikern praktiziert wird, hat einfachere Melodien mit kleinen Intervallen und fließenden Konturen, mehr gelenkt von einer abstrakten melodischen Logik als von einer raum-motorischen [spatiomotorischen]. Baily (1985, 1989) and Baily & Driver (1992) [...] haben argumentiert, dass das „raum-motorische Verfahren als ein legitimes und allgemein übliches Verfahren des musikalischen Denkens angesehen werden soll“ und dass musikalische Kreativität auch das „Finden neuer Wege, sich auf dem Instrument zu bewegen,“ umfasst.
[...]
Durch meine Erfahrung in Jazz-Improvisation am Klavier fand ich heraus, dass die kinästhetische Herangehensweise und die melodische Herangehensweise die beiden Extreme eines Kontinuums darstellen. Man steigert seine Imagination, indem man die Möglichkeiten erforscht, die sich aus der Beziehung zwischen Körper und Instrument ergeben, und beurteilt die Ergebnisse anhand seines abstrakten musikalischen Verständnisses und seiner Ästhetik. Unter den Jazz-Pianisten, die diese Beziehung genutzt haben, ist Thelonious Monk der einflussreichste. Seine Kompositionen und Improvisationen stellen mustergültige Verknüpfungen von Kinästhetik und Formalismus dar. Oft enthalten seine Stücke deutliche pianistische Eigenheiten, wie das wiederholte Pendeln zwischen 4., 5., 6. und 7. Stufe (in Misterioso (CD-3) und Let's Call This (CD-4)), Ganztonläufe und -muster (Four in One (CD-5), Bridge zu 52nd Street Theme (CD-6)), große und kleine Sekund-Zweiergruppen (Monk's Point (CD-7), Light Blue (CD-8)), rasante Figuren and ornamentale Filigranarbeiten (Gallop's Gallop (CD-9), Trinkle Tinkle (CD-10)). All diese Eigenheiten passen sozusagen in die Handbreite der Pianistenhand, während sie bei Bläsern (oder noch schlimmer bei Vokalisten) oft Chaos anrichten. Häufig ergab die Verwendung von solchem (aus der Kinästhetik abgeleitetem) Material bei Monk neben einem relativ leichten Ablauf am Klavier auch eine melodische und harmonische Mehrdeutigkeit. Er baute diese Elemente als fundamentale Teile in seinen Improvisationsstil ein. Auch wenn sie auf andere Instrumente (wie Saxofon) übertragen wurden, hatten seine klavierinspirierten Kompositionen oft revolutionäre Auswirkungen auf den improvisierenden Solisten – besonders deutlich in seiner Version von Trinkle Tinkle mit John Coltrane (Aufnahmen von den oben erwähnten Kompositionen können auf Monk 1986, 1994 gefunden werden).

Anfangstakte von Thelonious Monks Komposition Trinkle Tinkle
(Transkription des Autors, nur rechte Klavierhand)
[...] In Groove-basierter Musik besteht eine implizite Herausforderung, das, was einer spielt, auf einen intern erzeugten Puls zu beziehen – auf eine „vorgestellte Bewegung“ (wie oben erwähnt). Der legendäre Trompeter Doc Cheatham sprach über diese Beziehung: „Spielen ist wie Tanzen; es ist die Bewegung des Körpers, die dich anregt zu spielen. Du musst mit deinem Fuß klopfen …“ Er spricht nicht davon, den Rhythmus zu klopfen, den er spielt, sondern den darunter liegenden Puls im Gegensatz zu dem, was er spielt. – Ein Kollege von mir, der in verschiedenen tanzorientierten Salsa-Bands Bass spielt, hat bemerkt, dass er eine neue Dimension des rhythmischen Gefühls gewonnen hat, indem er die Tanzschritte gelernt hat, die zu dieser Musik verwendet werden. Alle Musiker dieser Gruppe vollziehen die grundlegenden Salsa-Tanzschritte, während sie auf der Bühne spielen; das erzeugt eine Verbindung des rhythmischen Bewusstseins analog zu Cheathams Spielen-und-Klopfen. Groove und Swing brauchen ein kontinuierliches, „körperliches“ Bewusstsein des Verhältnisses des Pulses zu dem erzeugten musikalischen Material. Verschiedene Musiker haben verschiedene Auffassungen über die Notwendigkeit der physischen Erzeugung des Pulses; zum Beispiel hat Steve Coleman mich in der Zusammenarbeit oft ersucht, mit dem Fußklopfen aufzuhören, offensichtlich weil es ihn störte. Aber die meisten Musiker, auch Coleman, scheinen über die Wichtigkeit, den Puls in seinem Körper zu spüren, übereinzustimmen. Das Gespür für Groove ist also zumindest zum Teil kinästhetisch; es geht dabei darum, die Aktivitäten und Sounds auf die Wahrnehmung des Pulses zu beziehen, den wir als eine virtuelle Bewegung erleben.
Es ist kein Zufall, dass das Gespür für den Rhythmus als „Feeling“ bezeichnet wird. Es ist eine gewisse Art der Aufmerksamkeit erforderlich, um dieses körperliche [embodied] Gespür für Groove zu erreichen. Nach der Auffassung vieler Musiker kann dieses Gespür verschwinden, wenn man versucht, es zu untersuchen. Musiker erklären oft einander, dass man über Rhythmus „nicht zu viel nachdenken“ soll. Sie meinen damit offensichtlich das symbolische Analysieren in Zahlen oder Worten. Vielmehr ist ein feines Rhythmusgespür eine Fähigkeit, die sich im Laufe der Zeit gewöhnlich durch eine aufmerksame, aber unabsichtliche Weise entwickelt. Letztlich haftet dem Rhythmuserleben und dem Rhythmusspielen eine beträchtliche Menge an Unerklärlichem an. Es gibt da eine ziemliche Armut der Terminologie und der Pädagogik, was diese diffizilen Aspekte des Rhythmus angeht.
Ein wichtiger Punkt im Thema der Kinästhetik in der Musik ist natürlich der Tanz. Tanz findet sich in allen Kulturen in einer großen Vielfalt, in weltlichem, religiösem und rituellem Zusammenhang. Arom (1991) beschreibt Musik im Afrika südlich der Sahara als eine Körperbewegungsaktivität, die fast untrennbar von Tanz ist. Er erklärt, dass unter vielen Einwohnern dieser Region Musikhören oft automatisch Körperbewegung bedeutet. Viele zentral- und west-afrikanische Sprachen haben kein Wort für Musik alleine und wenige betrachten Rhythmus als eine abtrennbare, abstrakte Komponente von Musik. Rhythmus wird als Stimulierung zur Körperbewegung verstanden und wird mit dem Namen des Tanzes bezeichnet. In der Anlo-Ewe-Kultur des südlichen Ghana ist das Wort, das unserem Begriff der „Musik“ am nächsten kommt, „Tanztrommeln“ (dance-drumming, ins Englische übersetzt von Ladzekpo).
Es erweitert unser Verständnis von Musik, wenn wir unsere üblichen Praktiken des Fußklopfens, Kopfwackelns, Fingerschnipsens als eine Art Vorform von Tanz verstehen, die aus der vorgestellten Bewegung bei der Wahrnehmung des Beats entsteht. Wenn wir Groove-basierte Musik als zum Tanzen gedacht verstehen (auch in dieser winzigen Form), dann beginnt sich eine mögliche Erklärung für das schwer fassbare Gespür des Grooves zu enthüllen. Die physische Wahrnehmung des Groove (beim Musikmachen wie auch beim Nachvollziehen durch den Hörer) umfasst sowohl die reale Körperbewegung als auch die vorgestellte Bewegung, mit der ein gleichmäßiger Puls wahrgenommen wird. Die reale Bewegung kuppelt in die vorgestellte ein durch auditorische und kinästhetische Rückkoppelung. [...]
Musikalische Körper in Kultur
[...]
Wenn wir von der Wahrnehmung der Musik über den Körper und die Interaktion zur physischen Umgebung sprechen, dann müssen wir die sozialen und kulturellen Kräfte diskutieren, die das Konzept des Körpers bestimmen. Ein wichtiger Unterschied der kulturell bedingten musikalischen Konzepte Europas und Afrikas betrifft genau die Bedeutung des Körpers – das Maß, in dem den physischen Umständen des musizierenden oder hörenden Körpers Beachtung geschenkt wird. Ein angehender Jazz-Pianist wird andere Aspekte des Klaviers wahrnehmen und anwenden als ein angehender klassischer Pianist. Thelonious Monk und Cecil Taylor haben Klaviere anders bearbeitet als Glenn Gould und Vladimir Horowitz. [...]
Die Unterschiede zwischen dem afro-amerikanischen Tanzmusikmodell und dem europäischen Konzertmusikmodell betreffen die Rolle des Körpers in den jeweiligen Kulturen und Genres. [...]
In vielen Kulturen sind Musik und Bewegung untrennbare Aktivitäten und der körperliche Einsatz der Musiker ist erwünscht und wird erwartet. Im Gegensatz dazu hat die westliche Kultur (mit ihrem Puritanismus und ihrem Argwohn gegenüber dem Körperlichen) über lange Zeit ihrer Geschichte auszublenden versucht, dass die Klänge, die die Musik ausmachen, tatsächlich üblicherweise von Leuten hervorgebracht werden. Zurück bis zu Platon hat die Fähigkeit der Musik, Körperbewegung anzuregen, Unbehagen ausgelöst und eine starke Tradition westlichen musikalischen Denkens hat sich dem Definieren von Musik als Klang an sich gewidmet – dem Auslöschen des Körperlichen, das sowohl beim Musikmachen als auch beim Musikhören beteiligt ist. (McClary 1991: 136)
[...] Im Gegensatz dazu besitzen viele Musikarten der Welt, die nicht mit einer gesellschaftlich strengen Hohe-Kunst-Tradition verbunden sind, und besonders die west-afrikanische und afro-amerikanische Musik einen körperbasierten Zugang zum Musikmachen. Sie betrachten den Körper nicht als ein Hindernis für die ideale musikalische Aktivität, im Gegenteil: Bei ihnen entwickeln sich viele musikalische Konzepte als Erweiterungen von körperlichen Aktivitäten, wie Gehen oder anderen repetitiven Prozessen. Die oben angeführten Bemerkungen zu Thelonious Monk zeigen, dass seine hochgradig experimentellen Musiktechniken in einem Umfeld entstanden, in dem er sich beim Erforschen der Beziehungen zwischen seinem Körper und dem Klavier absolut wohl fühlte. Er erlaubte sogar seinen musikalischen Ideen Gegenstand dieser Beziehungen zu sein.
Diese Verschiedenheit der kulturellen Modelle betrifft vor allem die jeweilige Auffassung von Rhythmus. Durch meine Erfahrung sowohl als Orchestergeiger europäischen Stils als auch als Keyboarder im Jazz- und Hip-Hop/Funk-Kontext habe ich eine starke kulturelle Verschiedenheit in der jeweiligen Rolle des Körpers bei der rhythmischen Aktivität festgestellt. Als Jugendliche im Geigensatz von Schul- und Gemeinde-Orchestern wurde meinen Kollegen und mir oft davon abgeraten, mit dem Fuß zu klopfen oder rhythmisch zu schwingen. Solches Verhalten wurde als linkisch und unpassend angesehen und vor allem drohte es, die Aufmerksamkeit vom visuellen Puls des Dirigenten abzulenken. In den zeitgenössischen tanzorientierten Bands, in denen ich spiele, setzen wir hingegen oft ganz gezielt eine Art von rhythmischem, körperlichem Einkuppeln ein. Das dient nicht nur einer visuellen rhythmischen Interaktion, um einen gemeinsamen Groove herzustellen, sondern hilft auch jedem Musiker, die Beziehung seines Parts zu seinem eigenen, intern erzeugten, körperlichen Puls zu fühlen.
In beiden kulturellen Modellen wird das Gespür für den Puls laufend gestützt; alle Beteiligten sind ständig fein aufeinander abgestimmt. Es ist jedoch im Fall des Dirigierens (das bei nicht elektrisch verstärkten Gruppen aus vielen Musikern notwendig ist) die visuelle Dimension vorrangig, während im anderen Fall eines Kollektivs der Groove vor allem durch die klangliche Dimension – ergänzt durch visuellen Input – aufrechterhalten wird. [...] Obwohl Jazz-Bigbands und moderne Salsa-Bands 15 bis 20 Mitglieder haben können, haben sie kaum richtige Dirigenten, sondern halten sich in rhythmischer Hinsicht an ein gemeinsames Gespür für den Puls [...]. In den Bigbands der Swing-Ära war die Rolle des Dirigenten oft bloß dekorativ, ohne entscheidende Funktion für den Ablauf der Musik, außer vielleicht für den Einsatz zu Beginn. Das zeigt, dass andere musikalische Elemente zur Präzision beitragen – vor allem die führende Rolle von Schlagzeug, Perkussion und Klavier, deren scharfe Anschläge eindeutige Einsätze für die gemeinsame rhythmische Gleichzeitigkeit darstellen. Neben diesen Perkussionsinstrumenten darf man die Rolle der Bewegungsempfindung und des visuellen Feedbacks zwischen den Musikern (und oft auch von Tänzern) nicht unterschätzen.
Embodiment und metamusikalische Sprache
[...]
[Visuelle Beispiele für „Ur“-Metaphern für Musik:] die Tonhöhe als Höhe, Klangfarbe als Farbe. (Im Rahmen meiner Erfahrungen des Musikunterrichts für Kinder habe ich festgestellt, dass sie zunächst die Tonhöhe nicht als hoch und tief wahrnehmen, auch wenn sie sich der Abstufung der Tönhöhe sehr wohl bewusst sind. So eine Abstraktion scheint also eine beliebige Konvention zu sein). Andere Metaphern mögen eine ökologische Bedeutung haben, wie die Verbindung von Lautstärke mit Größe; ein „großer“ Sound kommt gewöhnlich von einer physisch großen Quelle. Im Folgenden zeige ich einige weitere gebräuchliche musikalische Metaphern auf:
Musik als Raum
[...] Musikalische Zeit scheint – wie Zeit im allgemeinen menschlichen Erleben – sich vorwärts zu bewegen oder still zu stehen. Zeit wird überwiegend in einem horizontalen Sinn verstanden, was aus der Erfahrung des Herumgehens stammen dürfte. Rhythmische Zeit kann aber auch mit vertikalen Vorstellungen verbunden sein, im Sinne von Schwerkraft. Die vertikale Dimension wird sonst üblicherweise mit Tonhöhe und Harmonik verbunden. Aber wir haben beim Puls auch Up-Beats und Down-Beats. Rhythmen können grounded oder floating sein. Zeit kann aufgeschoben sein, ein Bassist kann walk a steady pulse. Ein Schlagzeuger kann four-on-the-floor spielen. Diese gebräuchlichen grundlegenden bildhaften Ausdrücke laufen auf eine Vertikalisierung der rhythmischen Phasen, das heißt auf eine „kreisförmige“ Zeit, hinaus. Das ergibt eine bezwingende Verbindung zwischen rhythmischem Puls und der Aktivität des Gehens, bei dem in einer repetitiven Weise die Füße gehoben und gesenkt werden. Das zeigt, wie Musik in der körperlichen Erfahrung gegründet ist; ein längeres rhythmisches Musikstück kann die metaphorische Vorstellung von einer Wanderung erwecken, bei der ein rhythmisches Schreiten mit einem schrittweisen visuellen Fluss der Umgebung verbunden wird. Gibson (1975) behauptet, dass diese Erfahrung des Gehens durch eine statische Umgebung die Grundlage bildet für unser (seiner Ansicht nach illusionäres) ökologisches Verständnis der Zeit als eine ständig fließende Quantität.
Musik als Sprechen
Musik trägt oft metaphorische Merkmale des Sprechens und der Konversation. Monson (1996) hat diese Metapher im Zusammenhang mit der Jazz-Improvisation ausführlich behandelt. Beispiele für diese Metapher hört man oft in der afro-amerikanischen Musikpädagogik, wo „sagen“ und „sprechen“ oft „spielen“ ersetzt. (Monson 1996: 84) Ein solcher Gebrauch unterstreicht, was die musikalische Darbietung mit dem Sprechen als Aktivität oder Verhalten gemeinsam hat, sowie, was die Musik mit der Sprache als ein symbolisches System gemeinsam hat. Unter den Merkmalen, die die musikalische Darbietung mit dem Sprechen verbinden, sehen wir, dass
Beachte, dass diese Aspekte des Sprechens und der aufgeführten Musik nicht auf den Bereich der Semantik eingeschränkt sind; das heißt, sie haben nicht ausschließlich mit den „intrinsischen“ Bedeutungen der Worte und Noten zu tun. Vielmehr kommt es bei diesen spezifischen Aspekten auf den Akt der Aufführung an.
Musik als Leben
[...]
Unter vielen Jazz-Musikern gilt es als wertvollste Eigenschaft, einen eigenen, sofort erkennbaren Sound zu haben, wobei „Sound“ nicht nur Klangfarbe meint, sondern auch Artikulation, Phrasierung, Rhythmus, melodisches Vokabular und sogar analytische Fähigkeiten. Letztlich geht es darum, eine Art „Persönlichkeit“ oder „Charakter“ zu haben, der einen von anderen Improvisatoren unterscheidet. Obwohl es ein Kompliment ist, wenn einem jemand sagt, dass man „wie Coleman Hawkins klingt“, ist es ein noch größeres Lob, wenn einem nachgesagt wird, „seinen eigenen Sound zu haben“. Der Posaunist und Komponist George Lewis schreibt: „Sound“, Sensibilität, Persönlichkeit und Intelligenz können nicht von der phänomenalen (im Gegensatz zu formalen) Definition von Musik des Improvisators abgetrennt werden. Vorstellungen von Person-Sein, wie sie durch Sounds übermittelt werden, und Sounds werden zu Zeichen für tiefere Ebenen der Bedeutung jenseits von Tonhöhen und Intervallen. (Lewis 1996: 117)
Diese Sichtweise unterstützt die weitverbreitete Interpretation von Improvisation als persönliche Erzählung, als eine, die den bedeutsamen Erfahrungen des Individuums eine Stimme verleiht. Der bahnbrechende Pianist Cecil Taylor schrieb über den ebenso bahnbrechenden Saxofonisten John Coltrane (CD-11): Kurz gesagt, sein Ton ist schön, weil er funktional ist. In anderen Worten, er ist stets damit befasst, etwas zu sagen. Man kann die Mittel, die ein Mann verwendet, um etwas zu sagen, nicht von dem abtrennen, was er letztlich sagt. Technik ist bei einem großen Künstler nicht vom Inhalt abgetrennt. (Taylor 1959)
Oft ergibt sich ein eigenständiger Stil eines Improvisators aus seiner (möglicherweise eigenwilligen oder selbst entwickelten) Technik. Ein autodidaktischer Zugang spielt da meist eine erhebliche Rolle [...]
[...] Ein individueller Sound, ein rhythmisches Gefühl, eine gesamte musikalische Herangehensweise werden als Indikator für das angesehen, wer einer oder eine als Person „ist“. [...] Zum Beispiel kann die Art der rhythmischen Platzierung im Bezug auf den Puls ein „feuriges“ oder „cooles“ Temperament widerspiegeln. Die melodische und harmonische Verfeinerung eines Musikers können eine auch jenseits der Bühne bestehende Urbanität und einen entsprechenden Esprit zeigen. Oft entspricht seine sonstige Persönlichkeit aber nicht der durch die Musik dargestellten. Die „musikalische Persönlichkeit“ kann eine Maske sein, ein „Signifyin(g)“. Jedenfalls zeigt sich in all diesen Fällen der Darstellung einer Persönlichkeit, wie sehr Musik und Leben in musikalischen Konzepten verbunden sein kann. Es ist ein kulturelles Modell, in der Musik eine Lebensart ist und umgekehrt.
Wir können diese Metapher der Musik als Leben auch in einem anderen Licht betrachten – wie sie in west-afrikanischer Musik auftritt. Ladzekpo (1995) zählt zu den wichtigsten Aspekten seiner Musikpädagogik das Verstehen verschiedener musikalischer Elemente im Sinn ihrer weltlichen Gegenstücke. Ein bestimmter Rhythmus kann als „künstlerische Animation“ einer realen Person angesehen werden. Ein konkretes Beispiel: Er hat ein rhythmisches Ostinato, das auf den Off-Beats auftritt, als den „Party-Tiger“ beschrieben – wegen der Art, wie er ständig vom Boden aufspringt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht:
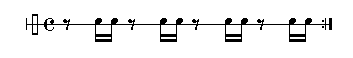
(Im Audio-Beispiel (CD-12) hört man ein Clicktrack [Metronom] neben diesem Trommelmuster, mit dem hohen Click auf dem Downbeat des geschriebenen Zeitmaßes). Auch wird ein steter rhythmischer Puls als „Zweckbestimmung im Leben“ gesehen, und rhythmische Hürden wie Kreuzrhythmen als „Herausforderungen“ in Bezug auf diesen Sinn für die Bestimmung. Meisterschaft in der rhythmischen Komplexität der Musik wird als eine Art von Festigkeit, als eine Fähigkeit, das Leben in Balance zu halten, verstanden. Ladzekpo beschreibt die Musik in der Anlo-Ewe-Kultur als repräsentativ für die „komplexe fundamentale Wesensart der Menschheit“ (Ladzekpo (1995).
Methaphern in Bewegung: Die Musik Cecil Taylors
[Iyer erzählt von seinen Erfahrungen in Cecil Taylor's Creative Orchestra im Jahre 1995. ...] 40 Musiker konnten unter Taylors Führung spielen und lernen. Taylors Herangehensweise sprach Bände über improvisierte Musik als kollektive Aktivität. Taylor sagte: „Das geschriebene Material ist der formale Inhalt eines Stückes. Ich möchte, dass jeder Musiker seine individuelle Sprache zur Interpretation und Ausführung des Stückes einbringt.“ – Das geschriebene Material war also nur ein Ausgangspunkt. In einer Woche täglichen Übens gewannen die Musiker den Eindruck, dass Taylor ein Pedant der Details ist. Wir standen drei Stunden lang in einer briefmarkengroßen Ecke und mussten ständig wiederholen und das Material Stück für Stück überarbeiten, während er vor uns singend und tanzend gewisse Phrasen vortrug und uns aufforderte, bestimmte geschriebene Teile in einer gewissen Weise umzusetzen. Aber gegen Ende der Woche wurden seine Anforderungen weniger streng, seine Führung weniger bestimmend. Schließlich setzte er uns einfach in Bewegung und verließ den Raum für eine Weile. Ich stellte fest, dass er uns seine Sprache beigebracht hatte – seine Art des Phrasierens und der Wiederholungen, seine Aufmerksamkeit für Details, sein rigoroses Überarbeiten und wie er eine „Runde“ von Phrasen zerlegt. Nachdem das geschehen war, waren wir frei, eigene Ideen in das Konzept einzubringen – also seine Sprache zu verkörpern [embody]. Als er in den Raum zurückkehrte, stellte er fest, dass wir etwas außerhalb seiner „Hieroglyphen“ machten. Offensichtlich bevorzugte Taylors Ästhetik den Sound von Persönlichkeiten, die miteinander interagieren. Schließlich hatte ich den Eindruck, dass wir mehr eine kleine musikalische Zivilisation bildeten als ein Orchester.
Tatsächlich erlebten wir im Kleinen Konflikte, Streit, Anspannung wie eine Gesellschaft im Großen. Vieles davon ereignete sich in der Aufführung am 26. Oktober 1995 auf einer musikalischen Ebene. Zum Beispiel gaben einige Musiker ihre Bindung an die ungeschriebene, zerbrechliche Ästhetik des Orchesters, die entwickelt worden war, auf (CD-13) und spielten nonstop mit wilder Intensität. Dieses Verhalten hob die Bedeutung der (körperlichen) Kraft hervor – klar, ein Tenor-Saxofonist kann einen Satz von sechs Geigern außer Gefecht setzen und ein Schlagzeuger kann leicht einen Pianisten begraben. Die lauteren Instrumentalisten konnten so den Intensitäts-Level bestimmen. Manchen Musikern ging es egoistisch darum „mit Cecil gespielt“ zu haben, im Hinblick auf ihre weitere Kariere. Ohne die diktatorische Führungsfigur und ohne genaue textliche Vorgabe befanden wir uns in ständigen Meinungsverschiedenheiten darüber, was angebracht ist und was als nächstes passieren sollte. Es entwickelten sich verschiedene Fraktionen, die ihre eigenen Kleingruppenaktivitäten betrieben und einzelne klarere Strukturen im Klangchaos errichteten. Die abschließende Aufführung zeigt echt subtile Blitze von zufälliger Schönheit und Momente brillant fokussierter Kleingruppen-Improvisation inmitten oft undurchschaubarem orchestralem Lärm. Die Metapher Musik-als-Leben wurde geboren aus unserer Erfahrung von Ensemble-als-sozialer Gruppe.
Was lehren uns diese zugrundeliegenden Metaphern über die Musik? Aus der oben dargestellten Diskussion wird klar, dass vor allem im Bereich des Jazz ein Verständnis der Musik aus der Beziehung zu seinem Körper, seinem Instrument, den Kollegen und der weiteren Kultur entsteht. Solche Schlüsse wurden auch von Berliner (1994) gezogen. Seine Kernaussage ist, dass man die für Jazz-Improvisation erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hauptsächlich aus der Kombination von einem Eintauchen in eine akkulturierte Gemeinschaft von Praktikern und von Stunden über Stunden des selbständigen Experimentierens auf seinem Instrument erlangt – das heißt, aus einem Zusammenfließen von „situiertem“ [situated] und „verkörpertem“ [embodied] Lernen.
Unveränderlichkeiten der Wahrnehmung
[...]
Eine Menge musikalischer Eigenheiten (vom Klang eines Instruments bis zur Wahl des musikalischen Materials beim Improvisieren) kann als eine Manifestation der darunter liegenden Unveränderlichkeiten der verkörperten Welterfahrung des Musikers angesehen werden.
Paralinguistik, Performativität, Signifyin(g)
[... Im sprachlichen Bereich gibt es die so genannten paralinguistischen Phänomene, wie zum Beispiel Handgesten, die die sprachliche Mitteilung ergänzen.]
Ähnliches gibt es auch bei der Musikperformance: Visuelle oder andere Faktoren, die die klangliche Mitteilung der Musik ergänzen. In der afro-amerikanischen Musik ist ein erheblicher Teil davon so genanntes „Signifyin’“. Dieser Begriff hat eine vielfältige Bedeutung. [...] Er bezeichnet eine Art Verschlüsseln einer Botschaft oder einer Bedeutung, was meistens ein Element des Umgehens ins Spiel bringt – ein freies Spiel mit rhetorischen Assoziationen, um eine Vielzahl von Bedeutungen jenseits der wörtlichen Bedeutung heraufzubeschwören. Es geht also um „Vertikalität“, um ein Zwischen-den-Zeilen-Lesen, um Mehrdeutigkeit, um ein Sich-Beziehen auf gemeinsames Wissen. [...]
Zum Beispiel wird in afro-amerikanischer Musik viel an Bedeutung durch laufendes Sich-Beziehen auf eine Fülle von kulturellem Hintergrundwissen vermittelt, ausdrücklich oder implizit. Im Jazz kann das (in einer vordergründigen Weise) durch das Zitieren einer allgemein bekannten Melodie während einer Solo-Improvisation erfolgen, oder durch ein Umschreiben eines melodischen oder rhythmischen Fragments, das jemand anderer schon gespielt hat. Oder es kann (in einer subtileren, hintergründigeren Weise) durch ein Konstrukt wie die Klangfarbe erfolgen (zum Beispiel indem sich der Alt-Saxofonsound von Eric Dolphy auf den Sound von Charlie Parker bezieht (CD-14)) oder durch die Art, wie ein Stück aufgebaut ist (betreibt Ornette Coleman in seinen Kompositionen ein Signifyin’ des melodischen Ausdrucks des Bebop? (CD-15)) oder (am abstraktesten) durch den „Sound“ oder die „Grundhaltung“ [attitude] eines Musikers (vermittelt Miles Davis’ Sinn für Raum, Timing und Melodie ein Gespür für den Blues? (CD-16)). Im Hip-Hop erscheint Signifyin’ in der Wahl des musikalischen Materials (wie die weit verbreitete, oft unverhohlene Verwendung von Samples von klassischen Funk- und Soul-Nummern (CD-17, 18)) oder in den Texten (zum Beispiel Bezug auf soziale Herkunft (CD-19)). Ein Rapper (MC) wird oft auch durch seinen „Flow“ charakterisiert, ein flexibles Konzept (analog zum „Sound“ im Jazz), das sich auf rhythmische Schärfe, textliche Kühnheit oder auf die gesamte persönliche Erscheinung (CD-20) beziehen kann. Die besondere Rolle solcher Parameter der Performance in den verschiedenen Arten afro-amerikanischer Musik zeigen die große Bedeutung der sozio-kulturellen Bezüge – für das Erzeugen der Musik und auch für das Hören und Verstehen der Musik.
[...] Bei einer Musik, die sich so sehr ihrer eigenen Herkunft bewusst ist, darf man die Dimension der Bedeutung, die durch das Signifyin’ ermöglicht wird, nicht übersehen, vor allem nicht die Möglichkeiten der Vervielfältigung der Bedeutung, die von der Metonymie [Namensvertauschung] der oralen Kultur selbst in Gang gesetzt wurde. Diese historische Dimension, diese Dimension der Möglichkeiten des Signifyin’, die in einem einzigen Stück Musik stecken, zu leugnen (entgegen dem Andenken an die Vorgänger), heißt, der Musik einen großen Teil seiner Bedeutung zu rauben.
Zeit und zeitliche Situiertheit
[...] Man kann prozessorientierte Aktivitäten (wie eine Rede oder das Spazieren) von ergebnisorientierten Aktivitäten (wie einen Roman schreiben oder eine Symphonie komponieren) unterscheiden. Prozessorientierte Aktivitäten sind in die Zeit eingebettet. Die Zeit bestimmt ihre gesamten Strukturen. Die Geschwindigkeit des normalen Gehens hängt von körperlichen Eigenschaften ab, wie dem Gewicht und der Länge der Beine […] Die Geschwindigkeit des Sprechens hängt von den zeitlichen Abläufen der Zungen- und Kieferbewegungen sowie dem Rhythmus des Atmens ab; innerhalb einer gewissen Bandbreite sind diese Prozesse durchaus flexibel.
Ergebnisorientierte Aktivitäten sind nicht „in“ der Zeit, sondern bestehen „über“ sie hinweg. Dass auch sie Zeit benötigen, ist nicht entscheidend für das Ergebnis. Das meiste, was wir als „Computation“ [Berechnung, Computer, alle Maschinen] verstehen, geht über die Zeit hinaus. Musikhören findet in „real-time“ statt. Es gibt eine „geteilte Zeit“ zwischen Hörer und den aufführenden Musikern. Anders ist es beim Lesen eines Buches. Das Partizipieren von Hörern und Musikern (Tänzern) an einem gemeinsamen Akt, bei dem Zeit durch rhythmische körperliche Aktivitäten strukturiert wird, verkörpert den Sinn für eine geteilte Zeit. Im Gegensatz zum körperlichen Partizipieren an einer gemeinsamen (geteilten) Zeit steht die „kontemplative“ Art des Musikhörens, wie sie in den europäischen Konzerthallen gepflegt wird, wo auf jede Art von Körperbewegung eines Zuhörers typischerweise mit negativem sozialem Feedback reagiert wird.
Die Zeitlichkeit der musikalischen Performance
[...]
Jazz-Performances können viele Arten zeitlicher Strukturen gleichzeitig haben: eine zyklische Form (Song-Form oder „Chorus“), rhythmische Segmente (Beat, weitere Unterteilungen, Metrum), Verbindungen zu Episoden (ein Solo, bestehend aus mehreren Chorussen), die gesamte Performance kann von einem Gefühl für eine angemessene Länge bestimmt sein.
Das Erlebnis des Hörens ist bei einer Musik, die als improvisiert verstanden wird, entscheidend anders als bei einer Musik, von der man weiß, dass sie komponiert ist. In der improvisierten Musik ist die wichtigste Ebene der Dramatik die Tatsache des gemeinsamen Sinnes für die Zeit: dass der Improvisator genau in der Zeit arbeitet, kreiert, musikalisches Material hervorbringt, in der wir als eine Art nachvollziehende Mitgestalter zuhören. Man erlebt eine Art von „Im-Moment“-, „In-der-Zeit“-Prozess der Kreativität und Interaktivität. Deshalb verstärkt die Improvisation die Rolle des Embodiments in der musikalischen Performance.
Durch Improvisation gestaltete Zeit ist in der Dauer flexibel und trägt die Möglichkeit der Endlosigkeit in sich, wie Baseballspiele. Beispiele wie Paul Gonsalves 27 Chorusse (über 6 Minuten lang) über Ellingtons Diminuendo and Crescendo in Blue (CD-21) und Coltranes 16-Minuten-Spiel über Chasin' the Trane (CD-22) (typischerweise beide Live-Aufnahmen) zeigen die Macht, die der Improvisator als Gestalter der Zeit hat, wie er über die Dauer und den Inhalt der gemeinsamen Zeit bestimmt.
Zeitliche Situiertheit und musikalische Form
Musik, die Improvisation bevorzugt, erfordert ein anderes Konzept der musikalischen Form als durchkomponierte Musik. Im ersten Fall kann die musikalische Form als zeitliche Situiertheit beschrieben werden. Es ist erhellend, das Konzept der Form in der klassischen, improvisierten Musik Indiens (CD-23) zu betrachten:
Syntaktische Formen sind in der indischen Musik so gut wie unbekannt. Stattdessen hören wir lange, zyklische Kettenstrukturen und ein allgemeines Fortschreiten des organischen Wachsens, das die Leitlinie ganz anderer formaler Modelle und Metaphern zeigt. Die Taktiken der Form gehen Hand in Hand mit den vorherrschenden Modellen der Strukturen: Hierarchische und syntaktische Formen werden durch Taktiken wie Kontrastierung, Parallelität, Vorbereitung, Anstieg, Überleitung und so weiter in Gang gesetzt. Serielle Formen [hintereinander, fortlaufend] wie in der indischen Musik tendieren dazu, modular [baukastenartig], dekorativ, schrittweise fortschreitend, mit offenem Ende zu sein. Die indische Version der musikalischen Struktur tendiert dazu, die Variation der Module [Bausteine] zu betonen: durch Vertauschen ihrer Elemente, durch Aufladen und Entladen ihrer Muster, durch Übereinanderlagern von Mustern und durch schrittweise, organische Entwicklung (Rowell 1988).
Improvisierte afrikanische und afro-amerikanische Musik hat oft viele dieser Merkmale, vor allem in der langfristigen Organisation des Materials. Die Hauptrolle der Improvisation in vielen oralen Musiktraditionen (verbunden mit der wichtigen Funktion des Grooves) machen alternative Auffassungen von musikalischer Form möglich, die nicht mit den rekursiven [auf sich selbst bezogenen] Hierarchien der Grammatik der tonalen Musik übereinstimmen. Ein teleologisches Konzept der Form, in dem die Bedeutung der Musik in ihren groß angelegten Strukturen gesehen wird, ist hier zu ersetzen durch eine andersartige, modulare Herangehensweise, bei der die Bedeutung der Musik im freien Spiel mit kleineren Gestaltungseinheiten liegt. So eine Auffassung von musikalischer Struktur findet sich in vielen afrikanischen und afro-amerikanischen Musikarten. Statt der groß angelegten hierarchischen Form liegt das Hauptaugenmerk auf den feinkörnigen rhythmischen Details und der Hierarchie rhythmischer Überlagerungen. Die größeren musikalischen Formen ergeben sich daher aus der improvisierten Gestaltung dieser kleinen musikalischen Bestandteile, das heißt aus der „In-der-Zeit“-Manipulation einfacher Komponenten nach einem modularen Organisationskonzept.
Ein ausgezeichnetes Beispiel ist die von James Brown häufig eingesetzte Praxis des „takin(g) it to the bridge“ (CD-24). Ein Stück kann aus zwei unterschiedlichen Teilen oder Grooves bestehen, wobei der Sänger zum Übergang von einem zum anderen auffordert. Jeder Teil kann beliebig lang sein, denn sein Ende wird allein vom improvisierten Zeichen des Sängers für den Übergang bestimmt. Vor dem Spielen wissen James Brown und seine Musiker noch nicht genau, wann das sein wird. [...]
Ein anderes Beispiel wurde mir vom Jazz-Schlagzeuger E. W. Wainwright erzählt: Elvin Jones hat ihm vom Titelstück der CD Transition (CD-25) von John Coltrane erzählt: Die Gruppe akzentuierte zunächst jeweils den Beginn des 4/4-Taktes (rhythmisch, melodisch, harmonisch). Im weiteren Verlauf dehnten sie den Takt auf 8/4, dann auf 16/4 und so weiter aus. Je länger die Perioden wurden, desto mehr stieg die Intensität und dissonante Reibung an und umso wirkungsvoller wurde die gemeinsame Auflösung der Spannung zu Beginn der nächsten Periode. Diese Praxis entwickelte sich organisch im Laufe von Hunderten Aufführungen, ohne dass sie jemals unter den Musikern besprochen worden wäre.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass Aspekte der musikalischen Form aus dem Gefühl für gemeinsam erlebte Zeit stammen können. [...] Im Jazz (und in anderen Musikarten) liegt der formale Schwerpunkt mehr in der Wiederholung, im Bezug auf ein gemeinsames Repertoire an Kenntnissen oder in der Aufrechterhaltung der Beziehung zu einem zusammengesetzten rhythmischen Muster [pattern] und weniger in Ableitungen aus einem Konzept, das man im Hinterkopf hat und mit dem man einzelne Teile zu größeren Gefügen zusammensetzt. Mit anderen Worten: Der Schwerpunkt auf das Geschehen im „Moment“ als einer Konsequenz des Embodiments bedingt andere Arten der formalen Gestaltung.
Ein Beispiel dafür ist wiederum John Coltrane: Er war schon zu Beginn seiner Kariere dafür bekannt, lange, eindrucksvolle, explorative Soli zu spielen, die dennoch voller Spannung und Vorwärtsbewegung waren, mit enorm schnellen Läufen, Filigranarbeit und Arpeggien, wie in Monks Stück Trinkle Tinkle (CD-26). Coltranes Improvisationen wurden weniger durch eine Hierarchie zusammengehalten, sie waren mehr seriell oder sequentiell. Manchmal wurde von seinen Soli gesagt, ihnen fehlte es an Richtung und sie wären zu lang. Viele haben versucht, „motivische Entwicklung“ in Coltranes einzelnen Improvisationen als das festzustellen, was Struktur schafft (Dean 1992, Jost 1981 [Ekkehard Jost, Free Jazz, 1981, S. 92-94]). Es scheint mir jedoch, dass dies bloß eine Folge einer größeren Formation ist: Coltranes „Sound“, seiner ganzheitlichen Herangehensweise, die diese Elemente hervorbringt. Das heißt nicht, dass Coltrane keinen Sinn für eine Strukturierung des Solos gehabt hätte. Aber diese Art der Analyse ist mehr durch die Art der Beurteilungskriterien eines Hörers bedingt als durch den Improvisator. Als Musiker glaube ich persönlich, dass der Improvisator mehr darauf konzentriert ist, einzelne Improvisationen hervorzubringen, die aufeinander und auf sein Konzept des persönlichen Sounds bezogen sind – weniger auf irgendwelche Vorstellungen von Kohärenz der einzelnen Improvisationen.
So fördert die zeitlich situierte Sicht der musikalischen Wahrnehmung eine nicht-lineare Herangehensweise bei der musikalischen Erzählung. Musikalische Bedeutung wird nicht bloß durch formale Hierarchien, motivische Entwicklungen, Kontur und zeitliche Verschiebung der Erwartung vermittelt, sondern sie ist auch verkörpert in der Improvisationstechnik. Musiker erzählen ihre Geschichten, aber nicht so sehr im Sinne traditioneller, linearer Erzählung. Ihre Erzählung wird durch die gesamte musikalische Persönlichkeit oder Grundhaltung vermittelt. Diese Grundhaltung wird sowohl musikalisch als auch außermusikalisch vermittelt, in dem Sinn, dass die musikalischen Symbole durch eine bestimmte körperliche Erscheinung, durch eine bestimmte Art des Verkörpert-Seins ergänzt werden. In der Praxis improvisierter Musik liegt der Schwerpunkt allgemein weniger in der einzelnen, isolierten Performance, sondern in dem sich entwickelnden Repertoire an Konzepten oder Ausdrucksmitteln, die dann für eine lange Zeit im Leben des Einzelnen bestehen bleiben. Die einzige unabdingbare Leitlinie für Soli oder Gruppenimprovisationen ist, dass man am Ende das Gefühl hat, „etwas gesagt“ zu haben. Die Details der Art und Weise, wie man das zustande gebracht hat, sind in der Musik genauso variabel wie beim Sprechen.
Embodiment als Ergänzung der Wahrnehmung
[...] Es gibt eine klischeehafte Unterscheidung zwischen literalen und oralen Kulturen, die meint: „Der literale Mensch speichert Informationen durch Schreiben; der orale speichert Informationen durch körperliche Aneignung: er wird zur Information.“ (Sidran 1971). Tatsächlich treten beide Arten der Informationsspeicherung im täglichen Leben der literalen Welt auf. [...] Zum Beispiel die Aufführung eines komponierten Stückes aus dem Standardrepertoire durch einen Konzertgeiger: [Iyer beschreibt viele Details, die für die Aufführung bestimmend sind … bis hin zu einem Zitat über eine „sadomasochistische Erfahrung“]
Ein anderes Beispiel bietet improvisierte Musik, zum Beispiel ein Jazz-Pianist, der über einen Standard improvisiert: [Iyer beschreibt wieder viele Parameter, schließlich auch:] Der Pianist kann sich (als Signifyin') auf eine etablierte Version eines Stückes beziehen (einschließlich seiner eigenen, so wie Ahmad Jamal heute Poinciana spielt, indem er bewusst seine unverwechselbare, sehr populäre Version von 1958 zitiert und modifiziert (CD-27)). Oder der Pianist kann seine Version durch bloße Kontextualisierung herausstellen (wie der absolut moderne Thelonious Monk es im Jahre 1963 mit der alt-modischen, heiteren Stride-Piano-Version der damals 40 Jahre alten, von Louis Armstrong popularisierten Melodie I’m Confessin’ tat (CD-49)). [...]
Oft wird die Ebene des Sozialen und Symbolischen als „höher“ charakterisiert und die Ebene des Körperlichen als „niedriger“, was aber irreführend ist, denn diese Funktionen interagieren wechselseitig. Insbesondere kann man nicht sagen, dass die „höheren“ Prozesse die „niederen“ leiten, denn es ist nicht klar, ob es überhaupt eine solche hierarchische Organisation gibt. Tatsächlich stammt die Tendenz, eine solche Hierarchie anzunehmen, von unserem Vorurteil, nach dem mentale Prozesse „höher“ sind als körperliche. Die kognitive Organisation zwischen „Körper“ und „Geist“ kann durchaus nicht-hierarchisch sein, wie folgendes Beispiel zeigt: In einer Improvisation nimmt ein Pianist ständig eine Auswahl vor. Die Wahl richtet sich nicht nur danach, welche Note, Phrase oder Geste „korrekt“ ist, sondern auch danach, welche Aktivitäten zurzeit durchführbar sind. Das heißt, ein geschickter Improvisator ist immer auch auf die im jeweiligen Moment bestehenden Beschränkungen eingestellt. [...] Solche Beschränkungen verbinden sich im Gesamten mit formalen Leitlinien wie Melodie und Harmonie. Improvisation (musikalische und andere) kann zum Teil als Dialektik zwischen formal/symbolischen und situativ/körperlichen Beschränkungen verstanden werden. Die Funktionen der situativen oder körperbezogenen Wahrnehmung ersetzen im Großen und Ganzen nicht die abstrakten, symbolischen kognitiven Prozesse (die wir mit „Denken“ assoziieren), noch gehorchen sie ihnen blindlings, sondern sie ergänzen und begleiten sie.
In diesem Kapitel habe ich also versucht zu zeigen, wie das theoretische Konzept der verkörperten und situativen Kognition auch das Studium der Wahrnehmung von Musik und das musikalische Verstehen bereichern kann.
[...]
5. Zur Wahrnehmung des Metrums
Das Metrum hat einen besonderen Status unter den verschiedenen Zeitspannen der Musik. Seine Funktion wird durch unsere verkörperten Wahrnehmungsfähigkeiten sowohl ermöglicht als auch beschränkt.
Rhythmische Zeitskalen
[Darstellung von Literatur zu diesem Thema]
Es gibt qualitative Unterschiede zwischen den drei Arten von Gedächtnis: dem Echogedächtnis, dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Dem Echogedächtnis entspricht die unmittelbare Zeitskala der rhythmischen Aktivität (die vordergründigen Rhythmusstrukturen). Dem Kurzzeitgedächtnis entsprechen Metrum und Phrasen (das mittlere Feld). Dem Langzeitgedächtnis entspricht die Zeitskala von musikalischen Abschnitten und Sätzen (der Hintergrund). – Wir kuppeln ein in den Puls, der auf der Echo-Erinnerung des vorhergehenden Pulses und auf einer angepassten, inneren Periodizität von Schwingungen beruht. Wir fühlen die Beziehung zwischen starken und schwachen Schlägen (Metrum der Akzente), wir zählen die Zeiten zwischen den Phrasen oder Takten (metrisches Gruppieren) und wir verknüpfen den Eindruck von einem Abschnitt mit den Erinnerungen an einen vorhergehenden Abschnitt, der nicht mehr in der Reihenfolge präsent ist. So können wir zum Beispiel Synkopierung auf der metrischen Ebene erleben und so genannte Dehnung oder Kontraktion auf einer höheren Ebene. Aber das ist qualitativ nicht dasselbe kognitive Phänomen. Denn die Wahrnehmung auf den verschiedenen Zeitskalen läuft sehr verschieden ab, aus einer kognitiven Perspektive betrachtet.
Wir tendieren also dazu, die Musik auf bestimmten Ebenen musikalischer Zeit zu organisieren, die mit den Zeitskalen der menschlichen Aktivitäten übereinstimmen. Hier kommt wieder das im vorigen Kapitel behandelte Embodiment ins Spiel. Dort besprachen wir drei qualitativ unterschiedliche körperliche Formen der zeitlichen Wahrnehmung: das schnelle Element des Sprechens und der Fingerbewegung, den gleichmäßigen Puls und den phrasenartigen Atem.
Pulswahrnehmung
Einer der wichtigsten Aspekte der rhythmischen Wahrnehmung, der experimentell nachgewiesen wurde, ist das geistige Einkuppeln in ein eingehendes, periodisches Signal. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns, mit dem Fuß zu einer Musik zu klopfen. Wir haben eine geringe Toleranz für Fehler im Signal, das heißt wir bemerken sofort geringe Abweichungen vom Rhythmus. [verschiedene Theorien dazu]
Wir erzeugen selbst in unserem Inneren einen periodischen Puls, den wir mit dem äußeren synchronisieren; das ist also dieses Einkuppeln. Das ist ein relativ simples Phänomen, das aber die Essenz der Pulswahrnehmung bildet.
[...]
Metrum
Der nächste Schritt vom Einkuppeln aufwärts ist ein komplizierteres Phänomen: die Wahrnehmung eines Metrums. Die Musikarten der Welt sind großteils metrisch organisiert, das heißt auf ein periodisches Gruppieren von Pulsen bezogen. Diese Gruppierungen können, müssen aber nicht in der musikalischen Oberfläche aufscheinen. Das Metrum kann, muss aber nicht aus einer Hierarchie aus starken und schwachen Schlägen bestehen. Das Metrum ist eine Subharmonie (oder Gruppierung) eines Pulses und kann auch eine höhere Harmonie (oder Unterteilung) desselben Pulses bedeuten. Das heißt das Metrum kann Pulse gleichzeitig sowohl gruppieren als auch zu regelmäßigen Einheiten unterteilen, zum Beispiel besteht der 6/8-Takt aus einem Zyklus von 2 Pulsen, von denen jeder in 3 gleiche Einheiten unterteilt wird. Das Metrum wird am besten als eine periodische Gruppierung von wahrgenommenen Pulsen verstanden, also als ein Phänomen der Kognition/Wahrnehmung, nicht als eine objektive Realität des akustischen Signals. Diese Unterscheidung wird oft ignoriert. So sprechen wir oft vom Metrum eines Musikstückes und treffen damit Annahmen über die Voraussetzungen für Hörer und Musiker. Studien über die Rhythmus-Wahrnehmung zeigen, dass das Metrum selbst eine mehrdeutige, wenn nicht sogar völlig imaginäre Eigenschaft eines Audiosignals ist. Ein bestimmter Rhythmus kann eine Anzahl von unterschiedlichen Puls-Eindrücken und metrischen Orientierungen bei verschiedenen Hörern oder bei verschiedenen Versuchen derselben Person auslösen.
Um dieses Problem zu umgehen, kann man zwischen der Funktion des Metrums bei der Musikerzeugung und der Funktion in der Musikwahrnehmung unterscheiden. Oder man kann das Metrum einfach definieren als eine interne, periodische Matrize, die sowohl die Wahrnehmung als auch die Aktionen strukturiert und zeitlich erdet. Diese Definition entspricht einem Modell, das von Povel (1984) vorgestellt wurde. Dieses Modell wurde aufgrund von Ergebnissen von Experimenten entwickelt, bei denen es sowohl um die Wahrnehmung als auch um das Nachmachen von zeitlichen Sequenzen ging. Es stellte sich dabei heraus, dass sowohl musikalisch trainierte als auch untrainierte Personen zeitliche Sequenzen auf inneren Strukturen abbilden. Im Modell besteht der erste Schritt der zeitlichen Verarbeitung von Musik aus einer Unterteilung der Sequenz in gleiche Intervalle (also in Beats), begrenzt durch Ereignisse. In einem zweiten Schritt werden Intervalle, die kleiner sind als das Beat-Intervall, als eine Unterteilung des Beat-Intervalls ausgedrückt. Die Beats und ihre Unterteilungen dienen dazu, die Wahrnehmung und Aktion in einer musikalischen Umgebung zu orientieren. Deshalb kann das Metrum als ein Aufmerksamkeits-Mechanismus angesehen werden.
Ein kleiner Mangel dieses Modells ergibt sich hinsichtlich asymmetrischer Metren, die unregelmäßige Zahlen von Beats oder einen unregelmäßigen Puls enthalten. In vielen Fällen (zum Beispiel in osteuropäischer, griechischer und in mittel-östlicher Volksmusik sowie in süd-indischer klassischer Musik) kuppelt man ein in eine Serie aus langen und kurzen Beats auf der Tactus-Ebene. Diese unterschiedlichen Arten von Pulsen treten fast immer im Verhältnis von 3:2 oder 2:1 auf und implizieren somit eine kleinere zeitliche Einheit auf einem untergeordneten metrischen Level. Diese Beispiele zeigen, dass ein Konzept von metrischen Strukturen nicht eine Regelmäßigkeit des Pulses verlangen darf, wenn es Allgemeingültigkeit beansprucht. Stattdessen sollte es wiederkehrende Gruppen von unregelmäßigen Pulsen auf der Tactus-Ebene, bestehend aus 2 oder 3 Einheiten, berücksichtigen.
Ebenso lässt sich die akzentbezogene Auffassung des Metrums (bei der eine metrische Matrize so verstanden wird, dass sie immer durch Akzente und mikro-zeitliche Variationen verstärkt wird) auf viele nicht-westliche Musikarten nicht übertragen. Man sollte das globale Vorherrschen von „Synkopen“ (Off-beat-Akzenten) nicht als eine große Anzahl von Ausnahmen von den „normalen“ Akzentregeln des Metrums betrachten, sondern als ein überzeugendes Gegenbeispiel zu diesen behaupteten Akzentregeln. Es sind verschiedene Signalverarbeitungstechniken entwickelt worden, um aus Musikaufnahmen Puls und Metrum abzuleiten. Aber typischerweise ergeben diese Versuche ständig unterschiedliche Resultate bei solchen „synkopierten“ Arten von Musik wie Jazz. Das ergibt sich dadurch, dass einem Audiosignal nicht notwendigerweise ein Metrum innewohnt. Das Metrum ist vielmehr eine Konstruktion der Wahrnehmung und der Kognition, abgeleitet aus gewissen wahrgenommenen periodischen Mustern von wahrgenommenen Akzenten (paradoxerweise einschließlich von Akzenten, die durch das imaginierte Metrum selbst vorgegeben werden), aber auch aus einer Reihe von Annahmen über das Metrum.
Tatsächlich treten Metrumangaben in den meisten westlichen Notenblättern aufgrund der Entscheidung des Komponisten auf, damit die Implikationen der Zeitangabe das Verständnis des Aufführenden und eine entsprechende Wiedergabe des Stückes festlegen. Aspekte des Metrums können in einer ausdrucksvollen musikalischen Aufführung vermittelt werden. In westlicher, tonaler Musik kann ein vorgegebenes Metrum eine bestimmte Matrize für Akzentmuster und Timing-Variationen im Sub-Tactus-Ausdruck nahe legen. Das Metrum gibt eine grundlegende Leitlinie für den Umgang mit Lautstärke, Klangfarbe und Timing vor, die die Intentionen des Komponisten vermittelt. Zusätzlich gibt es ein großes Vokabular an diakritischen Zeichen, um die Nebenbedeutungen des Metrums zu erweitern. Wegen all dem neigen wir dazu, vom Metrum als einem Stück Objektivität zu reden, weil es eben einfach die Zeitangabe ist, die links vom ersten Takt in den Notenblättern steht. Diese Tendenz wurde irrtümlicherweise in viele ethnographische Analysen ungeschriebener Musik hineingetragen, wo das „Metrum“ dann einfach das ist, was der Betreffende, der die Transkription vornimmt, wahrnimmt. In einer Studie einer fremden Musik sollte man sich des kulturellen Gepäcks bewusst sein, das mit einem musikalischen Konzept wie dem Metrum verbunden ist. Es mag ein analoges Konzept einer Orientierung an einem periodischen Gruppieren von Pulsen geben, aber das impliziert noch nicht alle anderen Eigenschaften des Metrums in dem Sinne, wie wir es in der westlichen Musik verstehen.
Manchmal wird der Begriff „Metrum“ auch dazu verwendet, um längere Periodizitäten (wie „Hypermetrum“) zu bezeichnen. Lerdahl und Jackendorff (1983) charakterisieren metrische Strukturen als eine hierarchische Verschachtelung von Beats zu beliebigen Graden von rückbezüglicher Tiefe. [… Einwände ...] Es scheint, dass das Metrum am effektivsten als relativ kleine periodische Gruppierungen des Hauptbeats funktioniert, und ganz unterschiedlich auf höheren Ebenen.
London (1997) hat behauptet, dass Polymeter nicht existieren, das heißt, dass man nicht zwei Metren gleichzeitig wahrnehmen kann. Da das Metrum nur im Geist des Hörers und des Performers existiert, können nicht zwei Metren zugleich in einem Geist „existieren“. Stattdessen kann man mehrdeutige Rhythmen hören, in denen unterschiedliche metrische Kandidaten konkurrieren. Das Resultat ist aber nicht eine gleichzeitige Wahrnehmung von zwei konträren Metren, sondern das Aufheben der Effekte eines Metrums durch das andere. Man kann der möglichen Präsenz von zwei unterschiedlichen Metren gewahr sein und man kann aktiv zwischen ihrer Wahrnehmung hin und her wechseln, so wie man es zwischen der Vase und den zwei Gesichtern in der klassischen, visuellen, mehrdeutigen Figur kann. Man kann also metrisch vage Musik hören, in der keine periodische Gruppierung von Pulsen naheliegt. Zwei Leute können unterschiedliche Metren in derselben Musik hören. Aber eine Person kann nicht gleichzeitig in zwei separate Pulsgruppierungen einkuppeln. In der klassischen, auf einer Kennzahl beruhenden Beziehung kann nur ein Metrum als Grundlage funktionieren. Die Behauptung gegen Polymetren scheint jedoch nur für Gruppierungen von Pulsen im Bereich des Tactus zu gelten. Man kann mehrfache Unterteilungen des Tactus finden (wie in einigen Beispielen der afro-kubanischen Rumba, wo wir Vierer- und Dreier-Unterteilungen im Übermaß finden (CD-28)). Genauso kann man gleichzeitig unterschiedlich lange Gruppen von Takten hören (wie in James Browns I Don't Want Nobody to Give Me Nothing (CD-29), wo wir leicht wahrnehmen können, dass die Vokals in 4/4-Takt-Phrasen erfolgen und die Bläser und das Schlagzeug in 3/4-Einheiten zirkulieren). Daher bezieht sich die Behauptung gegen Polymetren mehr auf die Ebene des Einkuppelns als auf die Wahrnehmung insgesamt, das heißt mehr auf den Akt des Imaginierens der Bewegung, die mit dem Rhythmus assoziiert wird, als auf den Akt des passiven „Hörens“ des Rhythmus.
Unsere Aufmerksamkeitskapazitäten sind treffend beschrieben durch das Zeitskala-bezogene Metrum, und zwar durch den Tactus. Es wird von vielen nahegelegt, dass das Metrum uns einen Aufmerksamkeits-Mechanismus verschafft – eine zeitliche Matrize für die Verarbeitung von Information in der Zeit. Das Metrum wird als eine unveränderliche Komponente des musikalischen Umfeldes angesehen, die aus immer wiederkehrenden zeitlichen Mustern errechnet wird. Als eine unveränderliche Komponente gibt sie uns eine Grundlinie, von der aus musikalische Variationen (wie musikalische Rhythmen und ausdrucksvolles Timing) effektiver wahrgenommen werden. Diese Auffassung wird von Experimenten gestützt, in denen Personen größere Schwierigkeiten hatten, Rhythmen wiederzugeben, wenn die Rhythmen keine deutliche allgemeine Zeiteinheit hatten.
[...]
Anhand einer Differenzierung nach verschiedenen Zeitskalen beschrieben Jones (1993) und Jones & Boltz (1989) unterschiedliche Musikhör-Strategien als verschiedene Arten der Aufmerksamkeit, und zwar eine zukunftsorientierte (langfristige, gedächtnisbasierte) gegenüber einer analytischen (kurzfristigen, wahrnehmungsbasierten) Aufmerksamkeit. Eigentlich ist diese Unterscheidung mehr relativ als absolut; es gibt Zwischenbereiche zwischen den beiden Extremen. Jedenfalls können wir die analytische Aufmerksamkeit mit der Zeitskala des musikalischen Metrums verbinden.
Diese Unterscheidungen führen zur Auffassung, dass das Metrum (in seiner zweckmäßigsten Form) einen schmalen Bereich des Rhythmusphänomens erfasst, im Groben begrenzt durch das, was als psychologische Gegenwart bezeichnet wird. Das Metrum funktioniert als ein Orientierungsprinzip innerhalb einer kleinen Zahl von (oft gleichmäßigen) Beats auf dem Tactus-Level – zwischen 2 und 8, grob gesagt. Eine metrische Gruppierung von Beats erstreckt sich über eine Dauer von ungefähr 800 Millisekunden bis 5 Sekunden, was bereits die Dauer des Echo-Gedächtnis (< 1 Sekunde) überschreitet, aber kürzer ist als die Spanne des Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnisses (~ 30 Sekunden). Offenbar müssen wir also unsere Definition des Metrums selbst ausschließlich auf die Bedeutung des Gruppierens des Tactus reduzieren. Daher sind weder das „Hypermetrum“ noch kleinere Unterteilungen des Hauptbeats („Mikrometrum“) echte Formen des Metrums. Man findet offensichtliche Ausnahmen von dieser Regel in einigen Adagios der tonalen Musikliteratur, wo sich ein festgeschriebenes Taktmaß über 10 Sekunden erstrecken mag, oder in einigen Allegros oder Prestos, wo ein festgeschriebenes Taktmaß eine halbe Sekunde oder weniger betragen mag. In solchen Fällen sind jedoch typischerweise das geschriebene Metrum und das wahrgenommene metrische Gruppieren weit davon entfernt, identisch zu sein. Das letztere ist sowohl unterschiedlich von einem Individuum zum nächsten als auch begrenzt durch unsere Aufmerksamkeitskapazitäten.
Im Lichte dieser Argumente sowohl gegen Polymetren als auch Hypermetren wird klar, dass die bei der Wahrnehmung erfolgenden Gruppierungen des musikalischen Tactus in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppen und so weiter (möglicherweise bis zu Achter-Gruppen) einen besonderen Status im rhythmischen Wahrnehmungsphänomen haben. Dieses unbewusste periodische Gruppieren von Pulsen zu einer Art Gestalt erschöpft sich bei der „magischen Zahl 7 plus oder minus 2“ (Miller 1956), also an dem Punkt, wo eine solche leichte Wahrnehmung unmöglich wird. Bei einer metrischen Länge jenseits davon brauchen wir entweder ein bewusstes Zählen, um mitzukommen, oder ein Gruppierungsverfahren für ein „Verklumpen“ [chunking] der Beats zu größeren Einheiten. Außerdem ist beim Metrum Vertrautheit ein Thema. Der Sound und das Feeling eines bestimmten Metrums muss erlebt werden, sonst funktioniert es nicht auf diese unbewusste Weise. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum 5-Beat-Gruppierungen westlichen Hörern fremdartig erscheinen, aber in der indischen Musik durchaus gebräuchlich sind. Weitere Bemerkungen über kulturelle Aspekte des Metrum finden sich in späteren Abschnitten.
Modelle der Wahrnehmung des Metrums
Large (1994) entwickelte ein bezwingendes Modell für die Beatwahrnehmung, das er danach (1997) auf die Metrumswahrnehmung anwandte. Er entwarf das Phänomen der Beatwahrnehmung als ein Koordinationsmuster, das zwischen einem innerlich erzeugten periodischen Prozess (einem selbsterhaltenden Oszillator) und einer Periodizität in einem komplexen externen Rhythmus auftritt. Der Hörer und der musikalische Input werden als ein einziges dynamischen System aus dem externen (treibenden) Rhythmus und dem internen (getriebenen) Oszillator angesehen. [... Einkuppelung ...] 1997 entwickelte Large auch die Idee, dass Netzwerke dieser Oszillatoren hierarchische Kombinationen erzeugen können, mit denen multiple Periodizitäten in einem treibenden Signal erfasst werden. Dieses Modell ermöglicht Hierarchien von Einkuppelung, wodurch eine fundamentale Pulsfrequenz (der Beat) und ihre Subharmonien (langsamere Periodizitäten) mit gewissen Phasenbeziehungen koordiniert werden. Auf diese Weise ergibt sich ein Modell für die Wahrnehmung des Metrums. Während es einige bezwingende Ergebnisse liefert, die auch bei expressiven Tempovariationen stabil sind, scheint dieses Modell entscheidende Aspekte unseres Wahrnehmungsapparates zu vernachlässigen, die uns zwischen Puls und Metrum unterscheiden lassen. Wie oben besprochen, verlangt die Idee eines Tactus einen elementaren Pulsbereich, der im Echogedächtnissystem angesiedelt ist, wohingegen die längeren Zeitskalen, die mit dem Metrum assoziiert werden, eine andere Art der Kognition ansprechen (Brower 1993). In diesem Modell, das alle Periodizitäten unabhängig von ihrer Länge als gleich behandelt, verabsäumt Large es, sein Modell in den verkörperten Fähigkeiten der menschlichen Zeitverarbeitung zu gründen. [...]
Ein anderer Versuch, ein Modell für die Rhythmus-Wahrnehmung zu konstruieren, (Todd u.a. 1998) geht stattdessen von einer sehr körperbezogenen, sensomotorischen Theorie aus. Die Autoren entwickelten ein Modell, das die natürlichen biomechanischen Frequenzen des Körpers und die zeitlichen Charakteristiken des auditorischen Systems berücksichtigt und die Beatwahrnehmung mehr als einen aktiven als passiven Prozess versteht. Zu einem Audio-Input wird eine selbsterzeugte Aktion simuliert und mit dem Input synchronisiert. [...] Das Modell scheint sich aber durch eine Überbetonung der sensorischen-motorischen (embodied) Komponente zu irren [...] Wir dürfen nicht die Rolle der Kultur in der Ausbildung unserer Wahrnehmung vergessen, auch bei der Wahrnehmung des Rhythmus.
RHYTHMUS UND METRUM IN WEST-AFRIKANISCHER MUSIK
Zu studieren, was andere über das Metrum in der Musik anderer Kulturen gesagt haben, hilft uns, die grundlegendsten, möglicherweise kulturübergreifenden Funktionen des Metrums zu verstehen. Wir müssen allerdings die kulturellen Neigungen aufdecken, die allzu oft solche kulturübergreifenden Studien kennzeichnen. Im restlichen Teil dieses Kapitels werde ich als Fallstudie zu einer Vielzahl von Gesichtspunkten verschiedener Ethno-Musikwissenschaftler, Psychologen und Theoretiker zu Metrum, Puls und rhythmischer Gruppierung in west-afrikanischer Musik Stellung nehmen. Nach meiner Auffassung sind viele dieser Studien von zwei auffallenden Tendenzen gekennzeichnet: einerseits von einer falschen Anwendung von musiktheoretischen Modellen und Musikwahrnehmungs-Modellen über Rhythmus und Metrum, die aus Studien der westlichen, tonalen Musik stammen; und andererseits einer wohlgemeinten Anwendung von missverstandenen Prinzipien afrikanischer Kultur und Musik. Obwohl die von Lerdahl und Jackendoff (1983) sowie anderen vorgeschlagenen Modelle sehr bemüht sind, Metrum und rhythmisches Gruppieren voneinander getrennt zu halten, tendieren die von westlichen Wissenschaftlern in der Erforschung afrikanischer Musik gesetzten Präzedenzfälle dazu, die beiden zu verwechseln. Außerdem neigen sie dazu, die Beschreibungen, die aus West-Afrika stammende Musiker und Musikwissenschaftler geliefert haben, entweder zu ignorieren oder zu stark zu vereinfachen. Viele sehr einflussreiche Arbeiten sind mit irreführenden Aussagen über solche Dinge wie Polymetren in afrikanischer Musik befrachtet. Zum Beispiel transkribierte Jones (1959) Rhythmen so, dass jede Phrase mit dem Downbeat eines neuen Metrums beginnt, sodass sich ein Wirrwarr von Metren mit unterschiedlichen Längen und vernachlässigbarer Wahrnehmungssalienz ergab. Im Folgenden versuche ich, die widersprüchlichen Gesichtspunkte, die Arbeiten wie die von Jones hervorgerufen haben, zu behandeln.
C. K. Ladzekpo – ein Perkussionist aus Ghana, prominenter Performer und Lehrer des „Tanztrommelns“ der Anlo-Ewe im Norden Kaliforniens – hat ein ausführliches Webdokument zur Technik, Praxis und kulturellen Funktion dieser Kunstform geschrieben. Er beginnt den Teil über die rhythmischen Techniken so:
In einer komplexen Interaktion von Beatmustern verschiedener rhythmischer Bewegungen sucht der menschliche Geist normalerweise nach einem Schwerpunkt. Bei den Anlo-Ewe ist eines der eingewobenen Beatmuster dominant und der Rest wird in einer kreuzrhythmischen Beziehung wahrgenommen. Dieses dominante Beatmuster wird als Hauptbeat angesehen, wegen seiner starken Akzente in regelmäßiger Wiederkehr, die das gesamte Gewebe durchziehen und regulieren. ...
In der Praxis ist das Beatmuster aus 4 Einheiten das am häufigsten benutzte. Bei einem gewissen Tempo ist die rhythmische Bewegung dieses Beatmusters die angemessenste (nicht zu langsam oder zu schnell) und die als Schwerpunkt am besten geeignetste. …
Um den Hauptbeat besser zu erfassen, ist er so strukturiert, dass er gleiche Schrittweiten der Pulsation ausmisst, wobei der erste normalerweise einen Akzent trägt. Diese Hintergrundpulsationen sind die wichtigsten ornamentalen Kräfte, die dem Hauptbeat seine bestimmte Textur, Würze und seinen Charakter geben. …
Die wiederkehrende Gruppierung des Hauptbeats erzeugt normalerweise eine feststehende musikalische Periode oder einen Takt. Es ist möglich, eine Reihe von Taktmustern durch verschiedene Gruppierungen des Hauptbeats zu erzeugen. Es sind jedoch zwei Arten dieses Gruppierens die häufigsten im Anlo-Ewe Tanztrommeln: Das erste der meistverwendeten Taktmuster besteht aus 4 Hauptbeats, wobei jeder Hauptbeat 3 gleiche Pulsationen misst und dadurch seinen spezifischen Charakter erhält. Das andere meist benutzte Taktmuster besteht ebenfalls aus 4 Hauptbeats, wobei jeder Hauptbeat aber 4 gleiche Pulsationen misst. Diese Beatmuster entsprechen ungefähr dem 12/8-Rhythmus und 4/4-Rhythmus in westlicher Musik.
Im Gegensatz zum westlichen Taktkonzept des Akzentuierens des ersten Beats jeden Taktes hat das Anlo-Ewe-Konzept regelmäßige Akzente auf allen Hauptbeats. Es besteht aber eine Tendenz, Phrasen (und auch ganze Kompositionen) auf der akzentuierten Pulsation des ersten Hauptbeats zu beenden, was die weitere Bewegung oder den Fluss andeutet. (Ladzekpo 1995)
Ladzekpo zeigt deutlich, dass das hauptsächliche rhythmische Organisationsprinzip ein zeitgleicher Puls in einem entsprechenden Taktintervall ist, typischerweise gruppiert in metrische Einheiten von 4 Pulsen und auch unterteilt in kürzere zeitgleiche Unterteilungen von 3 und 4. Die erste jeder Gruppe von Unterteilungen ist gewöhnlich akzentuiert, aber der erste jeder Gruppe von 4 Pulsen ist nicht stärker akzentuiert als die anderen 3. Der erste Puls einer Gruppe von 4 wird jedoch als Ende (im Gegensatz zum Beginn) vieler musikalischer Phrasen verstanden. Deshalb hat der erste Puls eine Vorrangstellung unter den 4 Pulsen und entspricht irgendwie der westlichen Auffassung von einem Downbeat, auch wenn er ein wenig anders funktioniert. Im Originaldokument sind alle Aussagen Ladzekpos ergänzend in westlicher Notenschrift beschrieben, um kulturübergreifende Unklarheit zu minimieren.
Die starken Akzente, die er nennt, sollten nicht als klangliche Akzente verstanden werden. Wie in Pantaleoni (1972) in Bezug auf die Musik derselben ethnischen Gruppe dargestellt wurde, entsprechen die Abstufungen der Lautstärke-Akzente im west-afrikanischen Trommeln nicht unbedingt jenen der europäischen Taktangaben wie 12/8 oder 4/4. Tatsächlich mögen Lautstärke-Akzente allein selten ein bestimmtes Metrum stützen, nach westlichen Standards. Für den „erfahrenen“ Hörer können im Tanztrommeln Akzente einen phänomenartigen (klanglichen, visuellen, taktilen) oder rein kognitiven (metrischen) Charakter haben. Wir haben nicht nur einen gewissen metrischen Sinn, der die rhythmische Aktivität mit konzeptuellen Akzenten erfasst, wir sehen auch die Fußbewegungen der Tänzer und die subtile Körpersprache der Musiker und fühlen die Stöcke, die die Trommeln schlagen und die Bodenerschütterungen. Solcher paramusikalischer Input ist in jeder aufgeführten Musik wirksam, weitgehend wie es paralinguistische Phänomene in der meisten sprachlichen Kommunikation sind (McNeil 1998); diese Aspekte sind Folge der situierten Kognition.
Viel west-afrikanische Musik ist durch variierende und sich wiederholende Rhythmen gekennzeichnet, die in Verbindung zu einer grundlegenden Timeline gespielt werden, wie zum Beispiel zu feststehenden Mustern, die auf einer Glocke gespielt werden. Der Glocken-Part fungiert als ein Bezugspunkt, indem er ständig wiederholte Muster erzeugt, die die anderen Musiker dazu nutzen, sich selbst metrisch zu orientieren. Aber man muss hinsichtlich der Nebenbedeutungen dieser Aussage vorsichtig sein. Welches Parallelkonzept des Metrums auch immer in diesen Kulturen besteht, so impliziert es doch nicht notwendigerweise dieselbe Vorlage von Akzenten und Gewichtungen wie das Metrum des Westens. Ich verwende das Metrum in dem Sinn, den ich im vorhergehenden Abschnitt vorgeschlagen habe, nämlich als ein wahrgenommenes periodisches Gruppieren von Pulsen der Tactus-Ebene. Die Nebenbedeutungen des westlichen Metrums, wie die einer Akzent-Matrize und einer Basis für expressive Tempo-Modulationen, werden von diesem generellen Verständnis des Metrums nicht umfasst.
(Um das Thema noch zu komplizieren: Die Anwesenheit der afrikanischen Diaspora-Musikarten im Westen und ihre immer häufigere Wiedergabe in westlicher Notenschrift haben die Unterschiede geglättet. Zum Beispiel kann ein Stück kommerziell erhältlicher Notenblätter neben der Tempo-Angabe eine Bemerkung wie „swing“ oder „slow funk groove“ oder sogar „afrikanisches 6/8-Feeling“ enthalten und dadurch eine rhythmische Gestaltung implizieren, die eindeutig nicht-europäisch ist, das heißt in Wahrheit aus afrikanischen Rhythmen abgeleitet (Wilson 1874). […])
Ein leitendes ästhetisches Prinzip in west-afrikanischen Musikarten bevorzugt rhythmische Gruppierungen, die die Intaktheit des Pulses herausfordern oder diesbezüglich Signifyin’ betreiben. Man muss beachten, dass eine wichtige Funktion der Aufführung von Trommelmusik in der psychologischen Balance besteht, die durch die Verinnerlichung scheinbar widersprüchlicher rhythmischer Einheiten auf der körperlichen Ebene erreicht wird (Ladzekpo 1995). Zum Teil des Kerns der Aktivität des Tanztrommelns gehört die Aufrechterhaltung der Balance (das heißt des Sinns für den ständigen gleichförmigen Puls, metaphorisch gesehen als Lebenssinn/-zweck) inmitten eines reißenden Stromes aus ineinander greifender Kreuzrhythmen (metaphorisch gesehen als Hindernisse) (Ladzekpo 1995). Das heißt nicht notwendigerweise, dass es die Absicht des Komponisten/Performers ist, Polymetren zu erzeugen, aber auch nicht das Gegenteil. Vielmehr ist die musikalische Konstruktion nicht im Sinne eines Metrums gestaltet, sondern im Sinne von gekreuzten rhythmischen Gruppierungen. Diese Gruppierungen können seriell, periodisch oder beides sein, um Parncutts (1994) Terminologie zu verwenden. Wenn beim Hörer zwei Metren erscheinen, dann deshalb, weil es hier periodische Gruppierungen von kurzen, seriell organisierten rhythmischen Fragmenten oder Phrasen gibt und ihre Periodizität ein anderes Metrum als das erste zu implizieren scheint. In dem oben dargestellten Sinne wird die Musik metrisch mehrdeutig. Am gebräuchlichsten ist eine gewisse Art von Dreier-Metrum, das über einer gewissen Art von Zweier-Metrum auftritt. Es wird im Kontext aber als eine Herausforderung, nicht als eine Alternative, zum vorherrschenden Metrum angesehen. Letzteres ist häufig für den Praktiker subjektiv so offensichtlich, dass es klanglich gar nicht deutlich dargestellt wird. Waterman (1952) betont auch die Wichtigkeit des subjektiven Beats in afrikanischer Musik, des zugrunde liegenden Pulses, der nicht notwendigerweise wirklich geschlagen werden muss. Er sagt, dass das Verständnis afrikanischer Musik einen „metronomischen Sinn“ erfordert. Europäische Musik unterstreicht den Hauptbeat, den Upbeat und den Downbeat. Im Gegensatz dazu unterstellen afrikanische Musiker selbstverständlich, dass ihr Publikum sich die fundamentalen Beats ohne Schwierigkeiten vorstellt. Das hörbare Material entfaltet seine Rhythmen um diesen mentalen Beat herum – oft unter Verwendung von Polyrhythmen, Kreuzpulsen, melodischen Offbeat-Akzenten und viel Indirektem und Subtilem. Deshalb brauchen wahrgenommene Gruppierungen im Audiosignal nicht das Metrum beschreiben und verlaufen häufig tatsächlich entgegen dem Metrum.
Wo ist also das Metrum in west-afrikanischer und ähnlicher Musik? Wenn die von Ladzekpo beschriebene Anlo-Ewe-Musik beispielhaft ist, dann gibt es hier sehr wohl ein Metrum – zuverlässig, unproblematisch, im Kopf des Musikers und genauso zuverlässig im Kopf des mit der Kultur vertrauten Hörers, auch wenn es in einigen objektiven Wiedergaben der akustischen Signale nicht offensichtlich ist. Man lernt den Hauptbeat, seine Untergliederungen und seine metrischen Gruppierungen; und dann lernt man den Rhythmus des Glockenmusters, der zugleich die Hauptbeats zu größeren Einheiten von 4 gruppiert und sie in kleinere Einheiten von 4 und 3 unterteilt. Dieses gleichzeitige Gruppieren und Unterteilen, das von diesem Bezugsrhythmus dargestellt wird, legt eine Art der Orientierung der Aufmerksamkeit und des körperlichen Einschwingens nahe. Es impliziert ein Set von Annahmen in ziemlich der gleichen Weise, wie die europäische Taktangabe ein verwandtes, aber unterschiedliches Set von Annahmen impliziert. Wenn man lernt, andere Rhythmen dieser Musik zu spielen, wird die Aufmerksamkeit kontinuierlich auf das gleichzeitige Glockenmuster gelenkt. Das geschieht nicht, weil die asymmetrische Glocke den regelmäßigen Puls ersetzen würde, sondern weil die Glocke die konsistenteste Darstellung des Pulses und seiner Organisation liefert. Akustische Verstärkung durch Akzentuierung ist nicht erforderlich und (nicht zufällig) keine Leitästhetik.
So wird der Hauptbeat und seine metrische Gruppierung in einer ziemlich indirekten Weise artikuliert – nicht durch eine kontinuierliche Vorführung einer Bestärkung durch Akzente, sondern durch Andeutung und Komplexität. Das Metrum ist im Rhythmus selbst verschlüsselt. Wie das geschieht, ist eindeutig, jedoch hochgradig kulturspezifisch. (Im folgenden Audio-Beispiel hört man ein Clicktrack [Metronom] neben dem graphisch dargestellten Muster, mit dem hohen Click auf dem ersten Beat des geschriebenen Zeitmaßes). Zum Beispiel wird das Standard-12/8-Glockenmuster des Anlo-Ewe-Volks auf folgende Weise phrasiert gehört (CD-30),

während dasselbe Glockenmuster mit einem unterschiedlichen Startpunkt beim Yoruba-Volk gehört werden würde als (CD-31)
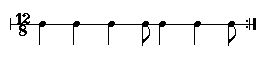
und noch bei einer anderen ethnischen Gruppe als (CD-32)
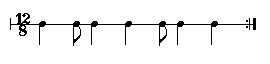
Weiters werden die Muster nicht notwendigerweise entsprechend der Taktstriche gruppiert. Zum Beispiel wird von den Yoruba-Mustern gesagt, dass sie so gruppiert werden, dass die letzte Note den so genannten Downbeat bildet (Anku 1992), das heißt (CD-33)
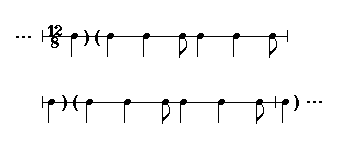
wobei die runden Klammern das Gruppieren über die Taktstriche hinaus zeigen. (Im Audiobeispiel wird das Gruppieren durch einen leichten Akzent in der Intensität auf der ersten Note jeder Gruppe angezeigt). Beachte, dass entsprechende Grenzen, die durch das Gruppieren und das Metrum impliziert werden, einander in diesem Fall nicht bekräftigen. Diese Möglichkeit wird in den entsprechenden Definitionen von Gruppierung und Metrum nicht berücksichtigt. Dieses Beispiel zeigt, dass sowohl die Platzierung des Tactus als auch die Gruppierung der Elemente von einer Gemeinschaft zur nächsten bezüglich eines einzigen rhythmischen Musters variieren.
Normalerweise werden die konstituierenden Beats und Unterteilungen von den afrikanischen Musikern nicht buchstäblich „gezählt“. Deshalb gibt es keine buchstäbliche „Eins“. Stattdessen werden Rhythmen häufig durch Merksprüche, die aus der Sprache abgeleitet sind, dargestellt – eine offensichtlich bevorzugte Technik in einer oralen Kultur. Ein Beispiel dafür ist der einfache Rhythmus, der im Westen als „3 über 4“ bekannt ist und von Ladzekpo dargestellt wird als (CD-34)
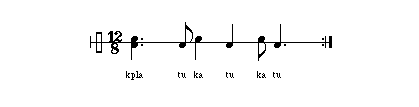
Dieses Beispiel ist lautmalerisch, aber es gibt genauso viele dokumentierte Beispiele von rhythmischen Merksprüchen mit semantischer Bedeutung (Anku 1992).
(Es gibt eine Henne-oder-Ei-Debatte über den Status dieser sprachlichen Phrasen: Sind die Rhythmen aus der Sprache abgeleitet oder sind die Phrasen beliebige Gedächtnisstützen um Rhythmen darzustellen? Ladzekpo (1995) betont die Allgegenwart von Symbolen und metaphorischen Verschlüsselungen in afrikanischer Musik, was die erstere Sichtweise unterstützt. Wie auch immer, die Tatsache, dass Sprichwörter lange mit vielen Rhythmen in vielen afrikanischen Trommelmusikarten assoziiert wurden, legt nahe, dass die Musik diese Bedeutungen trägt, wie auch immer sich ihre Herkunft erklärt.)
Die oben erwähnten Glockenmuster können als musikalisch kodierte Zeitangabe in einer in sich konsistenten musikalischen Sprache angesehen werden, wobei ein anderes Set von grundlegenden Prämissen gilt als das im Westen gebräuchliche. In vielen west-afrikanischen Musikkontexten lernt man die richtige Platzierung der Rhythmen nicht in Beziehung zu einem unterliegenden, abstrakten Metrum, sondern zu einem Glockenmuster. Es braucht kein ausdrücklicher Bezug zu einer unterliegenden, metrischen Abstraktion hergestellt werden. Eine Folge dieser Herangehensweise ist die Organisation von Phrasen bezogen auf den so genannten Downbeat, von W. Anku (Musikwissenschaftler aus Ghana) beschrieben als regulativen Zeitpunkt (RTP [regulative time point]) (Anku 1992). Statt eines Bezuges auf eine spezifische Unterteilung eines spezifischen Beats in der metrischen Hierarchie wird eine rhythmische Phrase in einer spezifischen Beziehung zum RTP verstanden. Improvisationen, die auf dieser Phrase beruhen, werden diese Beziehung aufrechterhalten, was die wiederholte Verwendung von dem abgibt, was in westlichen Begriffen als Auftakt bezeichnet werden mag. In der unten gezeigten Grafik sieht man einige Beispiele von rhythmischen Motiven mit unterschiedlichen RTP-Beziehungen, das heißt unterschiedlichen Phasenbeziehungen zum darunter liegenden Metrum. Die Gruppierungen sind durch runde Klammern um jedes Motiv herum angezeigt. Eine Phrase mit dem RTP n korrespondiert mit der RTP-Platzierung auf der n-ten Unterteilung vom Beginn der Phrase. Zum Beispiel wird das Glockenmuster als RTP 9 bezeichnet, weil die 9. Achtelnote der Phrase (beginnend nach der Gruppierungsklammer) der RTP oder Downbeat ist, wie durch das zentrale Rautenzeichen angezeigt wird.
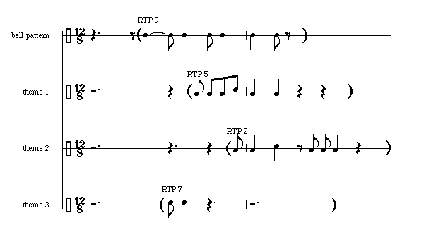
Die Beispiele wurden von Anku (1992) übernommen, der diese rhythmischen Phrasen als strukturelle Sets beschreibt – wegen der Art, wie sie das nachfolgende rhythmische Material organisieren. Der RTP korrespondiert mit dem Downbeat im angezeigten Zeitmaß. Ich habe hier für ein leichteres Verstehen Darstellungen vermischt. Das westliche Metrum wird verwendet, um die west-afrikanische RTP-Auffassung zu erläutern. (Im Audiobeispiel (CD-35) hört man wieder ein metrisches Clicktrack [Metronom], um das Ohr zu leiten, und wiederum werden die Gruppierungen durch leichte Akzente in der Intensität auf der ersten Note jeder Gruppe angezeigt. Wenn das Glockenmuster einmal etabliert ist, wird es durchgehend aufrechterhalten, während die Motive 1, 2 und 3 der Reihe nach dargestellt werden). Wiederum sind diese Phrasen oft sprachlich begründet und sie tragen die kodierte Bedeutung des Sprichwortes. Die Platzierung des RTP in solch einer Phrase kann das zusätzliche Element der sprachlichen Betonung nahe legen (das wir in der Musik „metrischen Akzent“ nennen können), wie etwa im Unterschied zwischen „Ich ging zum Geschäft“ und „Ich ging zum Geschäft“.
Deshalb bestimmt die RTP-Beziehung nicht nur durchgängig, wann eine Phrase im metrischen Zyklus, der von der Glocke unterstellt wird, zu beginnen hat. Noch wichtiger ist, dass diese Beziehung die Verteilung der Betonung anzeigt. Das ist ähnlich, aber nicht identisch mit der Vorlage der Akzente in der europäischen Musik – durch die Zeitangabe und insbesondere durch den Downbeat. Die RTP-Beziehung enthält jedoch eine stärkere Implikation von Wiederholung und Zyklizität als Auftakt und Downbeat. Ein bestimmter Abschnitt einer Trommel-Ensemble-Musik kann durch eine gewisse RTP-Beziehung charakterisiert sein [...]. Der Wechsel zu einer neuen RTP-Beziehung zeigt eine Überführung zu einem neuen Abschnitt an. Dieses Verfahren läuft auf eine andere Art von Metrumskonzept hinaus, bei der keinerlei Bezug zu einer mathematischen Abstraktion oder ihren angefügten Akzentmustern erforderlich ist.
Die wichtige Orientierungsrolle der Glockenmuster und das komplizierte Zusammenspiel der ineinander greifenden zyklischen Muster verlangen hochgradige Fähigkeiten sowohl im Analysieren der gehörten Szene (Bregman 1990) als auch in der konzentrierten Teilnahme (Jones 1993). Diese kognitiven Fähigkeiten werden in der westlichen tonalen Musik selten betont; sie tendiert dazu, weniger geschichtet und weniger rhythmisch dicht auf der Tactus-Ebene zu sein. Die zentrale Bedeutung des Streamings und der Teilnahme in der Musikwahrnehmung und Erfassung dürfte jedoch sowohl allgemein als auch im besonderen Fall der Trommelmusik offensichtlich sein. Ich komme auf die Idee des Streamings im nächsten Kapitel zurück, wo ich zeigen werde, wie gewisse Manipulationen die Trennung ähnlicher Ströme verbessern können.
Wahrnehmung des Metrums und Kultur
[...]
Es besteht oft eine Neigung, ein Afrika zu konstruieren, das sich immer vom Westen unterscheidet. Zweifelsohne kommt man über gewisse Unterschiede nicht hinweg, es ist aber überraschend, wie sehr das Bedürfnis nach Musizieren und die Umstände dabei in Afrika den in anderen Teilen der Welt ähneln und auf ein grundlegendes menschliches Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck hinweisen (Agawu 1995: 4-5).
[„Exotisierung“ afrikanischer Musik!]
[...]
Genauso wie wir nicht sagen können, dass alle westliche Musik immer von Anfang bis Ende linear ist, weil alles westliche Denken linear und rational ist (wobei nicht wirklich klar ist, was damit gemeint sein soll), so können wir auch nicht so grobe Verallgemeinerungen über die Gesamtheit afrikanischer Musik auf der Grundlage einer vage und spärlich erklärten kulturellen Tendenz treffen.
[...]
Wenn man west-afrikanische Musik lernt, wird man dauernd angewiesen, sich auf sein Verhältnis zur Glocke zu konzentrieren. Das ist aber nicht so wörtlich zu nehmen, dass man den Puls zu ignorieren hätte. Denn man wird auch dauernd daran erinnert, gegründet zu bleiben, was nach meiner Einschätzung bedeutet, am (meistens geraden) Puls zu bleiben. Dieses Verständnis von Puls ist sehr kontextabhängig. Es ist unbestreitbar, dass ein gegebener Rhythmus auf verschiedene Weise gepulst sein kann. West-afrikanische Musiker sind darin trainiert, ihre metrische Perspektive in einem Rhythmus zu verschieben und Kreuzrhythmen zu hören und zu erzeugen. Aber es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass hochentwickelte west-afrikanische Musiker alle möglichen metrischen Gruppierungen in solchem Maß gleichzeitig hören, dass sich jeder Anschein eines Metrums auflöst. Es gibt fast immer ein vorherrschendes Metrum, demgegenüber alle anderen metrischen Möglichkeiten ein Gefühl von Kontrast schaffen. Trotz der häufigen Bemühungen, afrikanische Musik als teilnehmend darzustellen, ist jedenfalls unbestreitbar, dass west-afrikanische Musiker hochgradig spezialisiert sind und ein Wissen und Verständnis haben, das weit über das einer durchschnittlichen west-afrikanischen Person hinausgeht (Agawu 1995: 116). Deshalb kann die extreme Kompetenz eines hochgradig trainierten Individuums nicht verallgemeinernd auf den ganzen Subkontinent übertragen werden. Gewiss, „innere“ musikalische Zeit bleibt eine mysteriöse und unerklärbare Dimension der Musikkognition im Allgemeinen. Aber das bedeutet nicht, dass es keine landläufige Übereinkunft über den Puls oder über Zeiteinheiten unter Mitgliedern eines Ensembles oder seines zuhörenden Publikums gibt [...]
[...]
Ich war mit rhythmischen Kontexten konfrontiert, mit denen ich nicht zur Gänze vertraut war, als ich kürzlich im Senegal gemeinsam mit einigen nordamerikanischen und britischen Jazz- und Funk-Musikern, vier afro-kubanischen Perkussionisten und fünf senegalesischen Trommlern arbeitete. Wir Westler hatten große Schwierigkeiten zu erahnen, wie die Rhythmen der afrikanischen Musiker zu hören gedacht waren, wie auch sie mit unseren hatten. (Wie man erwarten mag, waren diese Barrieren der musikalischen Sprache deutlich weniger extrem zwischen den Senegalesen und den Afro-Kubanern.) Einige von uns wurden zur lokalen Aufführung der senegalesischen Gruppe an einer Straßenkreuzung in Dakar mitgenommen. Obwohl einige von uns mit anderen Formen west-afrikanischer Musik in Berührung gekommen waren, hatten wir extreme Schwierigkeiten zu verstehen, wie ihre Musik und ihr Tanz, die für uns hochgradig mehrdeutig (metrisch und in anderer Hinsicht) waren, wahrzunehmen sind. Wir fanden uns wieder bei der Beobachtung des gelegentlichen Tanzens und Hüpfens kleiner Kinder, unserer einzigen wahrnehmungsmäßigen, hervorstechenden Orientierungsleitlinie.
Was diese Anekdote zeigt, ist, dass in diesen Kulturen (und in allen Kulturen, würde ich sagen) die Wahrnehmung des Metrums eine Praxis ist – eine absichtliche Tätigkeit mit offenem Ende, das heißt aktiv kultiviert von den musikalisch Beteiligten und zugleich tiefgreifend beeinflusst vom sozialen Kontext der Wahrnehmenden. (Siehe Berger 1997 und Bourdieu 1977 hinsichtlich einer ausführlichen Darstellungen dieses Konzepts). Die Wahrnehmung des Metrums ist nicht einfach eine grobe wahrnehmungsmäßige Zwangsläufigkeit, die durch mathematische Modelle des Hervortretens des Pulses und durch Gestaltkonzepte der Gruppierung ohne weiteres abgebildet werden kann. Im Gegenteil, man braucht entscheidendes Hintergrundwissen, um das „korrekte“ Metrum wahrzunehmen. Tatsächlich wird ein ungeübter Hörer aus dem Westen in einem west-afrikanischen Musikstück ziemlich häufig ein „unkorrektes“ Metrum wahrnehmen – aufgrund der Verwendung eines Standardprinzips minimaler Synkopierung. Im Audiobeispiel (CD-36) kann man versucht sein, ein Dreier-Metrum zu hören, die hoch klingende Glocke liefert aber den korrekten Zweier-Puls.
[...]
ZUSAMMENFASSUNG
[...] Ich fasse meine Argumente wie folgt zusammen:
Es sollte beachtet werden, dass einige metrumartigen Konzepte von kleinen oder großen Gruppierungen eines Pulses in einer großen Zahl von Musikarten der Welt existieren, einschließlich vieler europäischen, afrikanischen, süd-asiatischen, süd-ost-asiatischen und ost-asiatischen Musikarten. Manchmal wird dieses Metrum visuell verstärkt, wie in der dirigierten Orchestermusik Europas, im Tanzen, von dem west-afrikanisches Trommeln meist nicht getrennt werden kann, und in den Handsignalen, die von den Musikern und dem Publikum in der süd-indischen klassischen Musik produziert werden. Dann wiederum kann das Metrum musikalisch verschlüsselt sein, wie in den auf Timelines und der Clave beruhenden Musikarten der west-afrikanischen Völker und deren Diaspora, im auf Zwei und Vier gespielten Hi-Hat-Beat oder Backbeat der afro-amerikanischen Jazz- und Populär-Musiken und in der Verstärkung durch Akzente der tonalen Musik. [...]
[...] Wie Agawu plädiere ich für eine Zurückhaltung des Dranges, in vereinfachten Vorstellungen von kulturellen Unterschieden zu schwelgen.
Agawus einzigartiger Blickwinkel (als gebürtiger West-Afrikaner, aufgewachsen mit nördlicher Ewe-Musik und -Kultur, professionell ausgebildet in europäischer Musik und Musikwissenschaft) macht es ihm möglich, die typischen westlichen Darstellungen Afrikas in einer sehr wertvollen Weise zu kritisieren. Sein Standpunkt lässt sich sehr gut auf das Studium der afro-amerikanischen Kulturen und Musikarten übertragen. Als professioneller Musiker, der sowohl in mehreren afro-amerikanischen Genres als auch als Student der kognitiven Musikwissenschaft arbeitet, finde ich mich in einer ähnlichen, eigenen Position wieder – beim Aufdecken einiger weit verbreiteter Problematiken im Studium der Rhythmuskognition und beim Vorschlagen neuer Alternativen. In meiner Arbeit möchte ich Afro-Amerika nicht als eine eingefrorene Einheit darstellen, die einfach beschrieben werden könnte und die frei wäre von Interaktionen mit der vorherrschenden europäisch-amerikanischen Kultur. Vielmehr bemühe ich mich zu zeigen, wie das Studium afrikanischer und afro-amerikanischer Musikarten bisher unbeachtete Aspekte der Rhythmuskognition beleuchten kann, die gleichwohl global relevant sind.
Eine der interessantesten musikalischen Offenbarungen, die ich in meinem Leben erfahren habe, erlebte ich schrittweise in den letzten Jahren durch das Studium des west-afrikanischen „Tanztrommelns“ und durch das Spielen von Jazz, Hip-Hop und Funk. Die Offenbarung war, dass das simpelste sich wiederholende musikalische Muster mit einem Universum von Ausdruck getränkt sein kann. Ich habe oft miterlebt, wie der Perkussionist und Lehrer C.K. Ladzekpo aus Ghana die Musik unterbrach, um seine Studenten zu schelten, weil sie ihre Parts ohne Emotion gespielt haben. Man mag sich fragen, wie viel Emotion man auf einer einzelnen Trommel übermitteln kann, deren Tonumfang, Klangfarbe und eigene rhythmische Darstellung so begrenzt sind, dass die einzigen beiden Elemente, die einem zur Verfügung stehen, Intensität und Timing sind. Dennoch wurde ich davon überzeugt, dass gerade mit diesen beiden Elementen eine Menge ausgedrückt werden kann.
Rhythmischer Ausdruck in afrikanischer und afro-amerikanischer Musik
[...] Aus der Beschäftigung mit der belegten, historischen Abstammungslinie zwischen west-afrikanischen und afro-amerikanischen Kulturen hat Wilson (1974) eine Konstellation von konzeptuellen Tendenzen herausgefunden, die in den Musikarten dieser großen kulturellen Vielfalt existieren. Unter den musikalischen Präferenzen und Prinzipien, die er aufzählte, waren folgende:
- rhythmischer Kontrast
- Schichtung
- Wechselgesang (das heißt „Ruf und Antwort“)
- Verbindung zwischen Musik und physischer Körperbewegung
- Perkussivität
- Kontinuität zwischen Sprache und Sound
- Heterogenes Sound-Ideal
- Tendenz, den musikalischen Raum auszufüllen
- Auffassung von Musik als bedeutungsvolles „in Bewegung“-Sein als Teil des täglichen Lebens
Dieses Konzept und andere Konzepte können als Anfänge einer panafrikanischen musikalischen Ästhetik dienen, zumal so viele dieser Begriffe so oft in so vielen verschiedenen Arten west-afrikanischer und afro-amerikanischer Musik auftauchen. Eine große Mehrheit dieser Musik fällt in die Kategorie der Groove-basierten Musik, das heißt sie besitzt einen stetigen, nahezu gleichförmigen Puls, der gemeinsam durch ein Verzahnen hergestellt wird – durch ein Verzahnen, das aus rhythmischen Einheiten zusammengesetzt wird und das zum Tanzen bestimmt ist oder vom Tanz abgeleitet ist. Diese ein wenig unzureichende Beschreibung sollte nicht als eine Definition des Groove-Konzeptes betrachtet werden. In der Tat ist die Definition des Groove-Konzeptes – in gewisser Weise – das, wonach wir in dieser Arbeit suchen. Man kann sagen, dass Groove (neben anderen Funktionen) die Wahrnehmung eines menschlichen, stetigen Pulses in einer Musikperformance zur Folge hat.
In Groove-basierter Musik ist dieser stetige Puls das hauptsächliche strukturelle Element, wobei er in einer komplexen, indirekten Form artikuliert werden kann. In Groove-Kontexten entfalten Musiker eine gesteigerte, scheinbar mikroskopische Sensitivität für das musikalische Timing (im Bereich von ein paar Millisekunden). Sie sind in der Lage, verschiedene Arten rhythmischer Qualitäten wie offensichtliche Akzente oder emotionale Stimmung hervorzurufen, indem sie Noten im Verhältnis zu ihrer theoretischen, metrischen Platzierung ein bisschen später oder früher spielen. Während zahlreiche Studien die Nuancen expressiver Ritardandi und anderer tempomodulierender, rhythmischer Phänomene (Repp 1990, Todd 1989, Desain & Honing 1996) analysierten, gibt es unseres Wissens wenige sorgfältige quantitative Studien, die sich auf das expressive Timing in Bezug auf einen gleichförmigen Puls konzentrieren. In Groove-basierten Kontexten wird der subtile, rhythmische Ausdruck ein genauso wichtiger Parameter wie zum Beispiel Ton, Tonlage oder Lautstärke. All diese musikalischen Größen vereinigen sich dynamisch und ganzheitlich, um das zu bilden, was man das „Feeling“ eines Musikers nennen mag. Individuelle Spieler haben ihr eigenes Feeling, das heißt ihre eigene Art, sich auf einen gleichförmigen Puls zu beziehen. Auf dieser Ebene können musikalische Botschaften vermittelt werden. Ein Musiker kann hervorspringen aus einer polyphonen Textur durch eine „Abweichung“ vom strikten Metrum oder durch eine Reihe solcher Abweichungen. Wie ich unten zu zeigen versuchen werde, erzeugen diese Arten von Variationen in der Performance ein wahrnehmungsmäßiges Geben-und-Nehmen, um die verschiedenen Momente wechselwirkend zu betonen. Diese und ähnliche Techniken werden von erfahrenen Musikern mit großer Geschicklichkeit im Zusammenspiel gehandhabt – in einer Art Kommunikation auf der „Feeling“-Ebene. [...]
Wenn das Thema der musikalischen Kommunikation angesprochen wird, ist man oft versucht, sich zu fragen, was in all dieser Kommunikation gesagt wird. Das erhebt die Frage, was eigentlich eine musikalische Botschaft ausmacht, oder überhaupt die Frage der musikalischen Bedeutung im Allgemeinen. Hier mein ich, sollte man sich auf die prozessuale Auffassung von Kommunikation stützen als eine gemeinsame Aktivität, die Individuen harmonisiert – mehr als auf das telegraphische Modell von Kommunikation als überwiegende Übermittlung von buchstäblicher, verbaler Bedeutungen. Zum Beispiel kann die musikalische Idee des Ruf-und-Antwort-Spiels als eine Art der Kommunikation fungieren, ohne dass auf der begrifflichen Ebene etwas „gesagt“ werden muss (wobei die Möglichkeit einer musikalisch verschlüsselten symbolischen Bedeutung nicht auszuschließen ist). Was zweifelsohne tatsächlich geschieht, ist, dass die interaktive Ausführung, der Prozess und das Empfinden des Dialoges von den Musikern vorgeführt wird. In einem Kontext wie Jazz kann diese Art eines dialogischen Prozesses durch die ganze Performance hindurch anhalten – als ein anhaltender Wechselgesang. Ich behaupte, dass eine signifikante Komponente eines solchen Prozesses im Zuge einer musikalischen Dimension auftritt, die nicht notierbar im westlichen Sinne ist – nämlich als das, was ich Mikrotiming nenne.
Frühere Mikrotiming-Studien:
[...]
Die genannten Studien konzentrierten sich auf die Performance der europäischen klassischen Musik, die nicht in den Bereich der Groove-basierten Musik fällt.
[...]
Bilmes (1993) leitete eine Timing-Analyse einer Aufnahme von Los Munequitos de Matanzas, einer afro-kubanischen Rumba-Gruppe (CD-37). In einer Musikaufführung war der Durchschnittswert 110 Beats pro Minute (was ungefähr einer notierten Sechszehntelnote entspricht, die ungefähr 135 Millisekunden andauert). Sowohl die Quinto-Trommel als auch die Segundo-Trommel (die führende und mittlere Conga-Trommel) tendierten dazu, 30 Millisekunden voraus („on top“) zu spielen. Andererseits hatte die Tumbao-Trommel (die tiefe Conga-Trommel) eine viel größere Bandbreite; sie spielte fast so oft verzögert wie voraus. Es ist zu beachten, dass der präzise Moment des Beats NICHT durch die Norm festgesetzt wurde, die diese drei Instrumente selbst setzten (so wie es im Fall des klassischen Stringtrios oben war). Vielmehr wurde der Beat von einem Referenzinstrument etabliert, in diesem Fall von Clave oder einer Guagua. Deshalb war es für alle drei Instrumente möglich, dem nominellem Beat voraus zu sein (anders als im Fall des Stringtrios). In Bimes’ Arbeit wurde die durchschnittliche Asynchronie zwischen den Trommeln nicht berechnet. Tatsächlich würde eine solche Berechnung jede Beziehung zwischen Timing und musikalischer Struktur ignorieren. Eine Häufigkeitsanalyse der Mikrotiming-Variationen würde jedoch die systematischen Strukturen enthüllen. Zum Beispiel zeigt der sich wiederholende Segundo-Part einen starken Höhepunkt, der mit der Frequenz der Wiederholungen korrespondiert. Das zeigt, dass die Variationen des Mikrotiming keineswegs wahllos sind.
Ausgehend von dieser offensichtlichen Systematik des feinskaligen, rhythmischen Ausdrucks im Groove-Kontext können wir aus den oben besprochenen Resultaten von Drake & Palmer (1993) und Rasch (1988) sowie aus unserer erweiterten Sicht der Wahrnehmung, die die Theorie des Embodiments einbezieht, auf Annahmen über die Funktion solchen rhythmischen Ausdrucks schließen. Wir stellen daher die Hypothese auf, dass die Variationen des Mikrotimings in Groove-Musik eine der folgenden Rollen spielen:
- Hervorheben struktureller Aspekte des musikalischen Materials,
- Reflektieren spezifischer zeitlicher Bedingungen, die sich aus dem körperlichen Embodiment ergeben und/oder
- Ausführen gewisser ästhetischer oder kommunikativer Funktionen.
Ich werde nun alle diese Möglichkeiten anhand einiger Beispiele behandeln.
BEISPIELE VON EXPRESSIVEM MIKROTIMING
ASYNCHRONIE
[...] Rasch (1988) berichtet von einer früheren Studie über Asynchronie: von einem Experiment im Jahre 1977, mit dem er die Wirkung eines zeitlich unterschiedlichen Einsatzes von Tönen auf die Wahrnehmung von quasi-gleichzeitigen Tönen untersuchte.
Der Schwellenwert für die Wahrnehmung des höheren von zwei quasi-gleichzeitigen Tönen kann wesentlich erhöht werden (von zwischen 0 und -20 dB auf ungefähr -60dB), wenn eine zeitliche Differenz im Einsatz der Töne von etwa 30 Millisekunden eingeführt wird. In diesem Fall war der Schwellenwert weitgehend unabhängig von anderen Faktoren als den zeitlichen. […] Wird der Schwellenwert überschritten, dann trägt die Asynchronisation zur offensichtlichen Transparenz des gesamten mehrtönigen Klangeindrucks bei. (Rasch 1988: 80).
Eine Funktion der quasi-gleichzeitigen Anschläge (oder „Flammen“) kann es also sein, die Wahrnehmung der einzelnen Perkussionsinstrumente im Gesamtklang zu unterstützen.
Das angefügte Audiobeispiel zeigt diese Taktik (CD-38, 39).

In der ersten Version ist der Doppelschlag am ersten Beat im Wesentlichen synchron. In der zweiten Version wurde eine Verzögerung von 30 Millisekunden zwischen die beiden Töne eingeführt, sodass sich eine kleine „Flamme“ [flame] ergibt. Das dient dazu, die Wahrnehmung der beiden klanglichen Bestandteile zu steigern.
In einigen musikalischen Situationen, in denen Vermischung bevorzugt wird, kann diese Art der Asynchronie zwischen Instrumenten unerwünscht sein, in Groove-basierter Musik ist sie hingegen oft ein geschätztes musikalisches Mittel. In Wilsons Liste von afrikanischen und afro-amerikanischen ästhetischen Konzepten findet sich die Idee von einem heterogenen Sound-Ideal – einer Tendenz zur Wertschätzung der Gegenwart einer Vielfalt kontrastierender Klangfarben. Ein anderes wichtiges kulturelles Merkmal (das noch nicht erwähnt wurde) ist ein kollektivistisches Ideal, nach welchem Musik als eine gemeinschaftliche Aktivität innerhalb von Personengruppen hervorgebracht wird. Die oben beschriebene rhythmische Asynchronie unterstützt die Wahrnehmung einer Vielfalt von Klangfarben und genauso (aus einer ökologischen Sicht der Musikwahrnehmung; Gibson 1979, Shove & Repp 1995) die Vielfalt der menschlichen Körper hinter diesen Klängen. Das heißt die rhythmische Asynchronie unterstützt sowohl das heterogene Sound-Ideal als auch den Sinn für eine gemeinschaftliche Beteiligung. Wohl ist exakte Synchronie in Personengruppen nie möglich und das gilt sogar dann, wenn verschiedene Sounds von einem Individuum gespielt werden, wie am modernen Schlagzeug. Das ist aber etwas anderes als diese Art des subtilen rhythmischen Ausdrucks, der sowohl eine Wahrnehmungsfunktion als auch eine ästhetische Funktion erfüllt.
STREAMING
Es ist gut belegt, dass die auditorische Stream-Trennung eine Funktion sowohl von Tonhöhe als auch Klangfarbe ist (Bregman 1990). Aufgrund unserer Arbeit scheint auch Mikrotiming zum Streaming beizutragen. Diese Annahme baut auf der Rolle der Asynchronie in der Unterstützung der Wahrnehmung von mehreren Tönen auf. Die Audiobeispiele (CD-40, 41) bestehen aus einem ständigen Strom von Triolen auf den Tom-Toms gemeinsam mit einer Serie von einzelnen Tom-Tom-Schlägen mit geringerer Lautstärke. Das musikalische Material ist unten dargestellt.
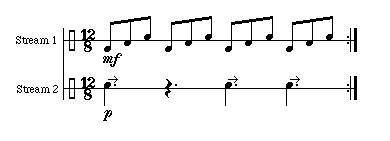
Im ersten Audiobeispiel sind die zusammenklingenden Schläge so gleichzeitig, wie es das MIDI-Protokoll erlaubt (das heißt innerhalb weniger Millisekunden von einander). Im zweiten Beispiel ist der zweite Stream um 30 Millisekunden gegenüber dem ersten verzögert (wie das von den Pfeilen in der Grafik angedeutet wird), wobei die geringere Lautstärke beibehalten wird. Im ersten Fall verschmelzen die verschiedenen Klangfarben zu einem Stream, während im letzteren Fall der zweite Stream klar als separate Einheit hörbar ist. Dieses Beispiel zeigt klar, wie solche winzigen Timing-Variationen zum Streaming beitragen können. Diese Technik ist vor allem in einem Kontext wichtig, wo die Ästhetik dazu tendiert, „den musikalischen Raum auszufüllen“ (Wilson 1974). Timing Variationen können es einem Instrument, das klanglich begraben ist, ermöglichen, in der auditorischen Szene die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Deshalb muss die Gegenwart von mehreren Instrumenten mit ähnlichen Klangfarben (wie in west-afrikanischen Trommel-Ensembles oder großen Jazz-Ensembles) nicht als verstärkte Unterordnung der individuellen Identität verstanden werden. Individuelle Musiker können auf dieser mikro-rhythmischen Ebene improvisieren, um hinsichtlich der Aufmerksamkeit ein Geben-und-Nehmen zu erzeugen. Dieser Streaming-Effekt dient auch einer ästhetischen Funktion, indem er die Wahrnehmung verschiedener rhythmischer Gruppen als separate, lebendige Einheiten mit eigenen „Persönlichkeiten“ verstärkt, wie Ladzekpo betont (1995).
SPREADING
Erst durch automatische Maschinen kamen menschliche Ohren mit unmenschlicher rhythmischer Präzision in Berührung. Eine klangliche Spur von zeitlichen Einschränkungen, die sich durch den Körper ergeben, wird oft als ästhetisch angenehm wahrgenommen, während das für unmenschliche rhythmische Regelmäßigkeit oft nicht gilt. Die folgenden Audiobeispiele (CD-42, 43) bestehen aus zwei Versionen „desselben“ Rhythmus, der unten gezeigt wird.
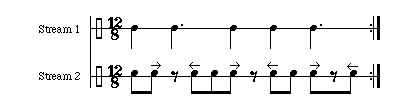
Im ersten Beispiel wird der Rhythmus so nahe am theoretischen Ideal wie am Computer nur möglich ausgeführt. Das zweite Beispiel enthält Timing-Abänderungen, die den Aspekt menschlicher Aufführung imitieren. Der Unterschied ist nicht einfach die Einführung einer beliebigen zeitlichen Ungenauigkeit. Vielmehr wird das Spreading miteinbezogen, das sich durch die fortlaufenden Anschläge, die von denselben hypothetischen Gliedmaßen oder Fingern gespielt werden, ergibt. Individuelle Organe wie Gliedmaßen, Hände oder Finger haben eine Zeitkonstante, die mit ihrer Bewegung verbunden ist. Die Nerven und Muskeln haben … [Hier scheint etwas im Originaltext zu fehlen].
Der rhythmische Ausdruck im oben angeführten Beispiel ist systematisch: Der erste Schlag jeder Gruppe von drei Schlägen ist ungefähr 30 Millisekunden voraus und der letzte Schlag ist ungefähr 30 Millisekunden verzögert (wie durch die Pfeile in der Grafik gezeigt wird). Zusätzlich zur Verstärkung der wahrgenommenen Separation beschreibt dieses Beispiel die Verschlüsselung der Körperbewegung im musikalischen Material. Nahezu alle Hörer sind mit der Art der Bewegung, die durch diesen synthetisch erzeugten Rhythmus angedeutet wird, vertraut. Aber diese Bewegung wird nur von der zweiten „unperfekten“ Version eindringlich vermittelt. Diese Beschreibung bringt also wiederum die Sicht des Embodiments, die ökologische Sicht der musikalischen Wahrnehmung ins Spiel – die Sicht, aus der der Hörer die Quelle der Klänge wahrnimmt – mehr als die Klänge selbst. In einer Musik, die stark die unmittelbare Körperbewegung einbezieht (Wilson 1974) und die eng mit den Erfahrungen des täglichen Lebens verbunden ist, ist die klangliche Spur des Körpers ein wertvolles ästhetisches Element.
Kodierung von Beständigkeit
Die oben erwähnten drei Beispiele zeigen die Auffassung der Beständigkeit. Auf der untersten Ebene stellt das ausdrucksvolle Mikrotiming eine Abweichung von der Regelmäßigkeit dar. […] Nach Gibson (1975) sind unsere Wahrnehmungssysteme auf Abweichungen und Beständigkeiten (Variationen und Invariationen) in unserer Umgebung ausgerichtet. Sie verarbeiten Veränderung. Beachte zum Beispiel, wie ein Vibrato oder ein Triller die Analyse einer auditorischen Szene dadurch erleichtert, dass dadurch die Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Instrument in einer sonst vermischten Textur eines Orchesters gelenkt wird (CD-44). Die Mikrovariation einer einzigen Tonhöhe reicht aus, um diese Stimme aus der auditorischen Szene hervortreten zu lassen.
Wir können eine entsprechende Verallgemeinerung für den Rhythmus treffen. Was in einem gleichmäßigen Pulskontext regelmäßig oder invariant ist, das ist die Norm, die von der Regelmäßigkeit der Pulsation erzeugt wird – zusammen mit ihren hervorspringenden Vervielfachungen und Unterteilungen. Was unregelmäßig ist, enthält das variable rhythmische Material – zusammen mit seinen ständigen expressiven Variationen. Mikro-rhythmischer Ausdruck signalisiert eine Abweichung von der implizierten Norm, um damit einen bestimmten Klang oder eine Gruppe von Klängen herauszustreichen, weil sie der Aufmerksamkeit oder der Analyse durch unsere Wahrnehmungssysteme wert sind. Dieses Argument trägt zu einer ökologischen Sicht der Rhythmus-Wahrnehmung bei, aus der wir auf Variationen in einer sonst regelmäßigen Umgebung ausgerichtet sind.
SWING
Eine Art des rhythmischen Ausdrucks, die in afro-amerikanischer Kultur einheimisch zu sein scheint, ist jene, die im Jazz der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht wurde. Bekannt als Swing, kann diese Art der Struktur als modifizierte Zweier-Unterteilungen des Hauptpulses oder als modifizierte Dreier-Unterteilungen oder als beides gleichzeitig aufgefasst werden. Als Zweier-Unterteilungen teilen sie das Intervall eines Pulses in zwei ungleiche Teile, von denen der erste ein wenig länger ist. Sie werden gelegentlich in Triolen notiert, als eine Viertelnote gefolgt von einer Achtelnote, aber das übertreibt das typische Swing-Verhältnis, das gewöhnlich in der Grauzone zwischen Zwei- und Drei-Teilung liegt und stark vom Tempo abhängig ist (typischerweise niederer bei schnellen Tempi und höher bei langsamen). Ein individueller Musiker hat einen gewissen Bereich von bevorzugten Verhältnissen und gewisse Arten sie zu handhaben, was zusammen entscheidende Dimensionen des Sounds, des rhythmischen Feelings und der musikalischen Persönlichkeit dieses Musikers bildet.
In einem entsprechenden Experiment über Rhythmus hat Fraisse (1982) die Fähigkeit von musikalisch trainierten und untrainierten Personen, rhythmische Muster in unterschiedlichen Graden von Komplexität wiederzugeben, untersucht. „Unrhythmische“ Sequenzen mit willkürlichen Verhältnissen zwischen Zeitintervallen bereiteten die größten Schwierigkeiten. In Fällen regelmäßigerer Rhythmen neigten die Personen dazu, die Verhältnisse zwischen den Intervallen zu vereinfachen – fast immer, indem sie zu genau zwei Klassen von Zeitintervallen gelangten: langen (400-800 Millisekunden) und kurzen (200-400 Millisekunden). Die Leute neigen dazu, Rhythmen in Bezug auf zwei, und zwar nur zwei Intervalllängen zu verstehen, grob gesprochen im Verhältnis von 2:1. Diese Tendenz zu einer rhythmischen Vereinfachung erinnert an ein klassisches Wahrnehmungsgesetz, nämlich an das Prinzip der Ökonomie in der Organisation (Fraisse 1982). In der Ausführung ist das Zahlenverhältnis gewöhnlich niedriger – tatsächlich näher zum Swing, ungefähr 1,75:1, ungefähr 57%.
Es ist jedoch nicht sofort offensichtlich, warum das Intervall ungleich geteilt wird. Es erschiene als einfacher und ökonomischer, wenn es nicht eine solche Differenz in der Dauer zwischen der ersten und der zweiten Note gäbe. Aber der Punkt ist der, dass diese Differenz die Wahrnehmung der rhythmischen Struktur auf einer höheren Ebene erleichtert. Eine unmittelbare Folge des Swing-Feelings ist, dass es die nächste Ebene der hierarchischen Organisation nahe legt. In konventionellen Begriffen: Das swingende Achtelnoten-Paar wird in der Wahrnehmung zum größeren regelmäßigen Intervall gruppiert, das heißt zur Viertelnote. Wenn alle Unterteilungen mit genau der gleichen Dauer wahrgenommen werden würden, wäre es schwieriger, den Hauptbeat wahrzunehmen. Die Verlängerung der ersten Note des Swing-Noten-Paars läuft auf eine Akzentuierung des Beats durch die Dauer hinaus. (Oft wird der zweiten Note des Swing-Paares in der Praxis ein leichter Akzent in der Intensität gegeben – als würde damit ihre kürzere Dauer kompensiert werden.) Deshalb fördert Swing die Wahrnehmung des Hauptpulses, wie das Beispiel (CD-45, 46) zeigt:
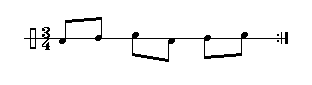
Die erste Version spielt alle Achtelnoten exakt gleich und ist daher metrisch unbestimmt, während die zweite Version einen leichten Swing enthält, was sofort den Puls hervorhebt.
IN THE POCKET: BACKBEAT-VERZÖGERUNG
Die Idee des Backbeats ist im modernen Schlagzeug beheimatet, einem Instrument, das von Afro-Amerikanern in diesem Jahrhundert hervorgebracht wurde. Er besteht aus einem stark akzentuierten Snare-Drum-Schlag oder Klatschen auf den Schlägen 2 und 4 eines 4-Beat-Metrum-Zyklus, bei dem der Beat typischerweise eine moderate Tactus-Frequenz hat (CD-47).
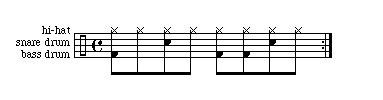
Der Backbeat scheint in der Mitte des 20. Jahrhunderts hervorgekommen zu sein, als der populäre Swing-Rhythmus in den noch populäreren, bombastischeren Rock-and-Roll-Rhythmus von Künstlern wie Little Richard und Chuck Berry mündete.
Floyd (1995) diskutiert in seiner musikalischen Interpretation von Stuckey’s (1987) Studie der Kultur der versklavten Afrikaner und ihres Einflusses auf die moderne afro-amerikanische Kultur das wichtige Ritual der afrikanischen Diaspora, das als Ring-Shout bekannt ist und das einen charakteristischen Raum darstellt, in dem unter anderem Musik und Tanz verschmelzen. Diese Aktivität „half zu erhalten […], was wir als die charakteristischen und fundamentalen Elemente der afro-amerikanischen Musik zu begreifen gelernt haben“, einschließlich „ständiger Wiederholung von rhythmischen und melodischen Figuren und Phrasen“, „Klatschen, Stampfen und Annäherungen daran“ und „des metronomischen Pulses, der der ganzen Musik unterliegt“ (Floyd 1995: 6). Als ein kulturelles Modell dient der Ring-Shout nach Stuckey als ein hermeneutischer [auf Deutung, Auslegung bezogener] Ausgangspunkt im Studium der afro-amerikanischen Kunstformen. Er verschafft eine alternative Perspektive, eine Perspektive, die mehr in afrikanischen als in europäischen Konzepten und Ästhetiken gegründet ist. (Siehe Rosenbaum 1998 für weitere Dokumentation des Ring Shout).
Der Backbeat, der in der afro-amerikanischen Popularmusik der Nachkriegszeit so gängig ist, scheint sich auf die Rolle des Körpers im Ring-Shout zu beziehen: Die Bass-Trommel (geschlagen mit dem Fußpedal des modernen Schlagzeugs) und die Snare-Drum (geschlagen mit der Hand und einem Stock) ersetzen jeweils das Stampfenbeziehungsweise Klatschen. Tatsächlich wird in der populären, urbanen Tanzmusik dem Snare-Drum-Klang des Backbeats oft ein tatsächlicher oder synthetischer Klatschklang aufgesetzt. Der stark repetitive Charakter des Backbeats verkörpert die zyklische, erdige Atmosphäre des Ring-Shout-Rituals. Obwohl er manchmal als stumpf und monoton abgetan wird, zapft er die hypnotische funktionelle Rolle der Wiederholung in solchen Ritualen an, in denen ein stetes, moderates Tempo, rhythmische Ostinati [sich stetig wiederholende Figuren] und Körperbewegung (Stampfen und Klatschen) in einem gemeinschaftlichen Rahmen verbunden werden, um ein gemeinsames multisensorisches Erlebnis zu erzeugen. Es erscheint als plausibel, dass die frühesten musikalischen Aktivitäten der Menschheit viele dieser Qualitäten besaßen. Der Backbeat wird am besten als ein zeitgemäßes, populäres Überbleibsel von dem verstanden, was vielleicht ein sehr ursprüngliches, menschliches Musikverhalten ist, gefiltert durch ein verfeinertes, stilisiertes, afrikanisches Ritual und durch Jahrhunderte der afro-amerikanischen Musikentwicklung.
Der merkwürdige Punkt ist beim Backbeat in der Praxis, dass er in der Ausführung eine mikroskopische Schiefheit zeigt. Wenn wir den Downbeat genau auf dem Schlag der Bass-Trommel liegend betrachten, dann wird die Snare-Drum sehr oft ein bisschen später als auf dem Mittelpunkt zwischen den aufeinanderfolgenden Pulsen gespielt (CD-48). Musiker sind sich dessen bis zu einem gewissen Grad bewusst und sie haben einen Ausdruck dafür: vom Schlagzeuger wird gesagt, er spiele „in the pocket“. Man mag sich zwar der exakten, zeitlichen Details dieses Effektes nicht bewusst sein, ein in diesem Genre erfahrener Musiker oder Hörer hört jedoch diese Art der ausdrucksvollen Mikro-Verzögerung als „relaxed“ oder „laid back“ im Gegensatz zu „stiff“ [angespannt, steif] oder „on top“. Dieser Effekt ist viel subtiler als die hervorstechende, rhythmische Kategorisierung der langen und kurzen Dauer des Swing. Es ist eine winzige Anpassung auf der Ebene des Tactus, weniger als die beträchtliche teilweise Verschiebung der rhythmischen Unterteilungen im Swing.
Was hat diese Verzögerung für eine Funktion? Vielleicht dient die Verzögerung als eine Art Akzent, zumal sie den Aufschub von etwas Erwartetem bewirkt (Meyer 1956). Es erscheint als plausibel, dass die optimale Snare-Drum-Verschiebung, die wir „pocket“ nennen, jene genaue rhythmische Position ist, die die Akzentwirkung einer Verzögerung maximiert ohne die Wahrnehmung des laufenden Pulses aufzuheben. Es geht also um die Balance zwischen zwei gegensätzlichen Kräften: die Kraft der Regelmäßigkeit, die der Verzögerung entgegensteht, und die Backbeat-Akzentuierung, die die Verzögerung verlangt.
Beachte, dass das Konzept eines Backbeats und der mit ihm verbundenen, leichten Verzögerung nicht zum Einsatz kommt, wenn nur eine einzige Stimme sowohl für den Downbeat als auch für den Backbeat eingesetzt wird (zum Beispiel: Das urbane Tanzmusikgenre, das als „House“ bekannt ist, verwendet eine gleichmäßige Bass-Trommel auf allen 4 Beats, wobei der Snare-Drum-Backbeat zeitweise aussetzt). Der Effekt scheint an den Unterschied zwischen zwei Klängen gebunden zu sein, und vielleicht auch an die tatsächlichen Klänge selbst und die vorgestellte, körperliche Aktivität, die sie hervorbringt. In einer diesbezüglichen Studie berichtet Friasse (1982):
Wenn man über Synchronisation spricht, muss man präzisieren, was mit was synchronisiert ist. Wenn man die zeitliche Trennung zwischen dem Tippen des Zeigefingers und dem Klang misst, findet man, dass das Tippen dem Klang um ungefähr 30 Millisekunden leicht vorgreift. Die Person nimmt diesen Fehler systematischerweise nicht wahr […] Dieser Fehler ist größer, wenn der Klang mit dem Fuß synchronisiert ist. Die Differenz zwischen Hand und Fuß erlaubt uns zu denken, dass das Kriterium der Person für das Synchronisieren das Zusammenfallen der auditiven und der taktilen-kinästhetischen Information auf der kortikalen Ebene ist. Damit dieses Zusammenfallen möglichst präzise ist, soll die Bewegung des Tippens dem Klang leicht vorausgehen, um die Länge der Übertragung der peripheren Information zu berücksichtigen. Diese Länge ist umso größer, je länger die Distanz ist. (Fraisse 1982).
Die Verzögerungsarchitektur läuft darauf hinaus, dass bei der wahrgenommenen Synchronisierung die Hand der Person nach dem Fuß kommt, solange der erwartete „Fehler“ für den Fuß größer ist. Das lässt erwarten, dass ein gleichmäßig wechselndes Stampf-Klatsch-Muster eine mikroskopische Asymmetrie enthält, ähnlich der, die im modernen Backbeat gefunden wird. Da sich die Bass-Trommel sowohl auf den Fuß bezieht als auch vom Fuß gespielt wird und die Snare-Drum sowohl auf die Hand deutet als auch von der Hand gespielt wird, ist es möglich, dass diese resultierende Verzögerungsstruktur auf das Schlagzeug übertragen wurde. Obwohl diese Argumente recht spekulativ sind, ist es plausibel, dass es eine wichtige Beziehung zwischen dem Backbeat und dem Körper gibt, wenn man das afro-amerikanische, kulturelle Modell des Ring-Shout kennt.
RHYTHMISCHER AUSDRUCK: ZWEI MUSIKBEISPIELE
Thelonious Monk spielt I'm Confessin' (CD-49)
Eine der faszinierendsten Geschicklichkeiten, die Monk und viele andere Pianisten dieses Genres gezeigt haben, ist ein hoher Grad von Unabhängigkeit zwischen den beiden Händen – bis zu einem Grad, bei dem eine Hand Rhythmen auszuführen scheint, die mehrdeutig sind, aber dennoch bezogen auf das, was die andere Hand ausführt. Das nimmt, wie beim Stride-Piano, oft die folgende Form an: Ein steter Puls oder repetitiver Bass-Rhythmus in der linken Hand (der „ground“) und im höheren Register rhythmisch freie Melodien in der rechten Hand (die „figure“). Ein klassisches Beispiel ist Monks Soloaufnahme von I’m Confessin’ (That I Love You) aus dem Jahr 1963 (Monk 1998). Nachdem in diesem Stück eine Zeit lang in der expressiven Stride-Art gespielt wurde, führen die letzten beiden Takte des ersten Chorus zu einem improvisierten, melodischen Fragment, das sich rhythmisch zu strecken und in den nächsten Takt zu purzeln scheint (CD-50).
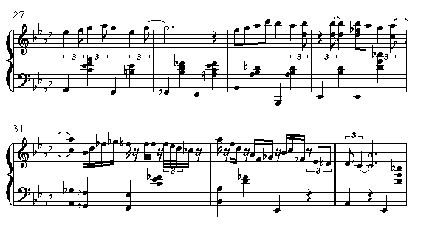
In diesem Ausschnitt übergeht die melodische Struktur in der rechten Hand die zugrundeliegende, rhythmische Struktur und setzt sie vorübergehend außer Kraft, nur um dann wieder genau zusammenzutreffen. Wir können Monks zweifelsohne fesselnde Gestaltung als rhythmisches Äquivalent für einen Kampf interpretieren, der die Norm der Pulsregelmäßigkeit, die durch das Vorangehende vorgegeben wird, betrifft. Es scheint um ein Beispiel für den Fall zu gehen, in dem eine solche Regelmäßigkeit für kurze Zeit geopfert wird, um einen extremen rhythmischen Ausdruck zu ermöglichen. Aber beachte, dass das Gefühl für den Puls nie verloren geht. Monk lässt ein paar Viertelnoten-Akkorde in der linken Hand aus, ansonsten betont er aber im Stride-Stil stark und exakt den Puls. Die rhythmische Untermauerung durch die linke Hand kompensiert die offensichtliche Abweichung von der Regelmäßigkeit.
Als ich die Aufnahme von diesem Stück einem Raum voll von Studenten der Kognitionswissenschaft vorspielte, von denen vermutlich die meisten mit Jazz nicht vertraut waren, führte dieser Ausschnitt zu einem Ausbruch von spontanem Gelächter. Einiges von Monks Ergebnissen ist ausreichend kommunikativ, um das, was man von den traditionellen Abgrenzungen der Genres erwarten mag, zu überschreiten. Indem er den regelmäßigen Puls nahezu außer Kraft setzt, nimmt Monk eine Gelegenheit wahr und entscheidet sich, einer melodischen Idee zu folgen, die ihn vorübergehend rhythmisch weit außerhalb bringt.
Die Frage, ob Monk „beabsichtigte“, das in genau dieser Weise zu spielen, ist abwertend, verwandt mit der Verdinglichung der Rolle von „Fehlern“ im Jazz (wie in Walser 1995). Aus der Perspektive eines Improvisators wird die Vorstellung von einem Fehler durch das Konzept des Ausdrucks seiner Interaktion mit den Strukturen ersetzt, die vom klanglichen Umfeld nahe gelegt werden. Es ist nie klar, von was in improvisierter Musik erwartet wird, dass es eintritt. Deshalb ergibt es keinen Sinn, über Fehler zu sprechen. Dieser improvisationsfreundliche Rahmen ermöglicht das musikalische Erkunden und Experimentieren, einschließlich der spontanen, rhythmischen Variation in der hier beschriebenen Art, ohne die Vorstellung von Fehlern heraufzubeschwören.
Ahmad Jamal spielt But Not for Me (CD-51)
Ein wunderbar improvisierter, spielerischer Geist ist in der Trioversion des Pianisten Ahmed Jamal vom Standardstück But Not for Me aus dem Jahre 1952 meisterhaft festgehalten. In diesem Stück handhabt Jamal sein Verhältnis zum Puls aktiv und willentlich durch eine geschickte Verwendung von Mikrotiming-Variationen. Nahezu jede einzelne Phrase in Jamals Darbietung enthält einige interessante mikro-rhythmische Manipulationen. Ich möchte mich hier aber auf einen Ausschnitt konzentrieren, und zwar auf das Ende des ersten Chorus bis zum Beginn des zweiten Chorus. Bei Takt 31 führt Jamal eine sich wiederholende 3-Beat-Figur in den metrischen 4-Beat-Kontext ein. Diese zusätzliche rhythmische Technik ist in der afro-amerikanischen Musik gebräuchlich und Jamal führt sie in extremer, humorvoller Weise aus, indem er die bluesgefärbte Figur volle 12 Mal (9 Takte) kreisen lässt. Die ersten 4 Takte dieser Passage werden unten gezeigt. Ich habe mich an die Konvention gehalten, die swingenden Rhythmen mit gleichmäßigen Achtelnoten darzustellen, es sollte aber verstanden werden, dass es in dieser Passage viel mehr gibt, als in der Grafik zu sehen ist. Insbesondere spielt Jamal diese Figur extrem hinter dem Beat, so sehr, dass der humorige Effekt der sich wiederholenden melodischen Figur dadurch, dass sie in ein starreres Relief gegossen wird, im Gegensatz zum gewöhnlicheren rhythmischen Hintergrund gesteigert wird (CD-52).

In diesen 4 Takten beträgt die Viertelnote durchschnittlich 469 Millisekunden (128 Beats pro Minute). Die Notenereignisse auf dem Piano, die als auf den Beat treffend gezeigt werden, tendieren dazu, tatsächlich ungefähr 40% später zu beginnen als die Rimshots des Schlagzeugers, die oben mit X-en angezeigt sind. Das platziert ihn mehr als eine Triole hinter dem Beat. Außerdem tendiert Jamals zweite Note in jedem swingenden Paar dazu, bei ungefähr 85% des Weges durch den Beat einzutreten. Damit ist gemeint, dass das Swing-Verhältnis hier tatsächlich umgedreht ist: Die erste Achtelnote in einem verzögerten Paar dauert ungefähr 45% eines Beats (weniger als die Hälfte) und die zweite dauert ungefähr 55% (mehr als die Hälfte). Es scheint also, dass die Wahrnehmung des Swing ansteigt entsprechend komplexer Variationen in Timing, Intensität oder Artikulation. In diesem Fall geht es nicht um ein Erreichen des „korrekten“ mikro-rhythmischen Verhältnisses.
Wie streift Jamal diese offensichtliche rhythmische Zuwiderhandlung eines umgedrehten Swings ab? Die Antwort scheint in seiner 40%igen Phasenverschiebung im Verhältnis zum Beat, der von den begleitenden Instrumenten etabliert wird, zu liegen. Wenn er (während dem Aufrechterhalten dieses Phasenverhältnisses) am üblichen Swing-Verhältnis von ungefähr 57% festhalten würde, wäre die zweite Note in einem Swing-Paar nahe genug am Einsatz des nächsten Beats (nur ein paar Prozent früher), um als auf dem Beat gespielt gehört zu werden. Durch den Einsatz einer Vorwegnahme der zweiten Achtelnote in jedem Paar entgeht Jamal diesem Problem, statt direkt „zwischen“ den Beats zu klingen. Die 40% Verzögerung ermöglicht ihm auch genug rhythmische Mehrdeutigkeit, sodass der umgedrehte Swing nicht misstönend klingt. Außerdem erhöht Jamal das Gefühl von Swing durch das Akzentuieren des jeweils zweiten Paares (eine gebräuchliche Technik, wie früher erwähnt wurde). Es liegt hier somit der Fall vor, dass eine Art des rhythmischen Ausdrucks mit einer anderen interagiert: Das übliche Lang-Kurz-Verhältnis des Swing ist geändert, um die „Laid-back“-Qualität einer melodischen Figur unterzubringen.
Was wird durch das Spielen in dieser Laid-back-, Behind-the-beat-Art erreicht? Man mag dieselben einfachen Wahrnehmungseffekte (wie das Steigern der Stream-Trennung) erwarten, wenn er stattdessen zum Beispiel vor dem Beat gespielt hätte. Hinter dem Beat zu spielen ist aber eindeutig eine kulturelle Ästhetik in der afro-amerikanischen Musik, vor allem im Jazz. In einer nicht veröffentlichten Studie fand Bilmes (1996) heraus, dass ein west-afrikanischer Trommler gleich oft vor wie hinter dem Beat spielte, während man gelegentlich beobachten kann, dass fähige Jazz-Improvisatoren dazu tendieren, wesentlich öfters dahinter als davor zu spielen. Vom ökologischen Gesichtspunkt aus mag das Spielen hinter dem Beat normalerweise mit einer körperlichen oder mentalen Entspannung assoziiert werden oder es mag ein ursächliches Verhältnis nahelegen, bei dem das musikalische Material eine Reaktion auf den Puls ist. Solche Hypothesen würden weitere Erforschungen verlangen.
In diesem Kapitel habe ich einige Aspekte des rhythmischen Ausdrucks diskutiert, die ziemlich unterschiedlich gegenüber dem üblichen Aufbau der Aufführungstechniken der europäischen klassischen Musik sind. Statt (oder zusätzlich zu) Ausdruckskonzepten wie Rubato, Ritardando und Accelerando haben wir absichtlich asynchrone Zusammenklänge, subtile Trennungen von rasch aufeinander folgenden Noten, asymmetrische Unterteilungen eines Pulses und mikroskopische Verzögerungen festgestellt. Als weitere Illustration haben wir extrem geschickte Handhabung von feinmaßstäblichem rhythmischem Material in Beispielen aus dem Jazz-Idiom gesehen. Ich habe mich auf afrikanische und afro-amerikanische Musikarten konzentriert, weil sie diese Konzepte oft isoliert von der möglichen Interferenz von Tempo-Variationen aufweisen und weil sie dazu tendieren, perkussive Klangfarben einzusetzen, was die präzise mikro-rhythmische Analyse erleichtert. Ich habe dargelegt, dass afrikanische und afro-amerikanische Musikarten Ästhetiken enthalten, die diese Arten des mikro-rhythmischen Ausdrucks schätzen. Dennoch glaube ich, dass diese Techniken in unterschiedlichem Maß in der gesamten Musik, einschließlich des europäischen klassischen Genres, zu finden sind. Im nächsten Kapitel präsentiere ich eine Darstellung rhythmischer Strukturen, die die detaillierte Handhabung des expressiven Mikrotimings in der oben diskutierten Vielfalt berücksichtigt.
7. Beschreibung rhythmischen Verhaltens,
Darstellung rhythmischer Strukturen
In diesem Kapitel diskutiere ich eine Gruppe von Modellen für das rhythmische Klopfen, die in der Literatur der letzten paar Dekaden entwickelt wurden. Ich diskutiere, was ich als einen Fehler dieser Modelle betrachte, zu denen ich eine ergänzende Sichtweise nahelege, die unterschiedliche mentale Prozesse bei den unterschiedlichen Zeitmaßstäben berücksichtigt. In diesem Licht beschreibe ich dann die Arbeit, die von Bilmes (1993) initiiert wurde und die von einer aus Jeff Bilmes, Matt Wright, David Wessel und mir (Iyer u.a. 1997) bestehenden Gruppe fortgesetzt wurde. Diese Arbeit kulminierte im Entwurf und in der Einführung einer neuen Darstellung rhythmischer Strukturen, die die für Groove-basierte Musik spezifischen Gesichtspunkte (wie die in den vorhergehenden Kapiteln diskutierten) berücksichtigt:
Rhythmisches Klopfen
Die bekannten Studien von Wing & Kristofferson (1973), Verborg & Hambuch (1984), Jagacinski u.a. (1988) sowie Verborg & Wing (1996) befassen sich mit dem Enträtseln der kognitiven Befehlsstruktur im Timing der motorischen Aktivität. Wing & Kristofferson (1973) leiteten Experimente, bei denen Personen mit ihrem Finger periodisch mit einer moderaten, steten Frequenz klopften. Das Klopfen der Personen war zunächst auf periodische Töne abgestimmt und dann unterblieben die Töne und das Klopfen war unbegleitet. Die Experimentatoren studierten, wie genau die ursprüngliche Frequenz beim unbegleiteten Klopfen aufrechterhalten wurde. Aus ihren Daten entwickelten sie ein Modell, bei dem vermutet wurde, dass es zwei unabhängige Quellen der Schwankungen in dieser unbegleiteten Phase gibt: 1.) Schwankungen im Timing der zentral gesteuerten, periodischen Befehle des Vorwärtsschubs und 2.) Schwankungen in der Ausführung (mechanische Verzerrungen im Effektor, Reaktionsverzögerungen der Nerven und so weiter). Die Schwankungen im Klopfen wurden als Summe dieser beiden zufallsbedingten Variablen betrachtet. Durch einfache Statistiken über die Intervallwerte konnte man ermitteln, welche der beiden Variablen zur jeweiligen Veränderung in der gesamten Schwankung geführt haben. Zum Beispiel wurde entdeckt, dass die typische Negativkorrelation zwischen aufeinanderfolgenden Intervallen („negative Kovarianz bei Verzögerung 1“) zur Gänze mit einer Schwankung in der Ausführung verbunden ist. In anderen Worten: Der natürliche „Swing“, der in einem persönlichen geklopften steten Puls steckt, wird nicht von Schwankungen der Erzeugung der zentral gesteuerten Befehle durch das Gehirn verursacht, sondern von den motorischen Prozessen, die mit dem Körper verbunden sind.
Pressing und andere (1996) arbeiteten mit erfahrenen Musikern, um herauszufinden, dass systematische Schwankungen im so genannten polyrhythmischen Klopfen (durch Analyse der Schwankungskovarianz der geklopften Intervalle messbar) eine hierarchische kognitive Struktur in der Rhythmusproduktion implizieren. Vor allem gibt es eine Differenz in den Mikrotiming-Beugungen des 4:3-Klopfens eines Musikers (4 Klopfer in gleich bleibendem Abstand über die Länge von 3 geklopften Beats) gegenüber seinem 3:4-Klopfen – auch wenn es theoretisch „derselbe“ Rhythmus ist. Diese systematische Schwankung stimmt mit einem hierarchischen Modell überein, das einen zentralen Taktgeber, einen getrennten Prozess des referentiellen Timings und motorische Verzögerungen einbezieht.
Das allgemeine kognitive Modell, das von den oben erwähnten Autoren hinsichtlich der Produktion von Polyrhythmen vorgeschlagen wird, ist folgendes:
Es ist möglich, dass die Ergebnisse, die die Differenz zwischen 3:4 und 4:3 zeigen, ein Umgießen [recasting] der Arbeit von Drake und Palmer (1993, im früheren Kapitel diskutiert) auf einer niedrigeren kognitiven Ebene darstellen. Wenn es tatsächlich eine nennenswerte Menge an Mikrotiming, das sich auf das Metrum bezieht, geben sollte, dann könnte es im Unterschied zwischen der so genannten Figur [figure] und dem Grundstrom auftauchen. Pressing und andere beziehen sich nicht auf das Metrum, es ist aber klar, dass der Grundstrom in diesem Kontext metrisch funktioniert. Der zentrale Befehlstaktgeber funktioniert als ein Puls. Die Zwischenpulsintervalle werden für das akkurate Timing des Figurstroms unterteilt. Dennoch haben Magill und Pressing (1997) versucht, einen asymmetrischen zentralen Taktgeber zu postulieren – aufgrund der Betrachtung west-afrikanischer Musik, die ihre so genannten Zeitlinienmuster mehr als „Grund“ denn als Figur behandelt. Diese Arbeit wurde im Kapitel über das Metrum diskutiert und kritisiert.
Ein Subtactus-Taktgeber
Ein Problem, das ich bei allen oben zitierten Arbeiten sehe, ist, dass niemand jemals ein Modell für das rhythmische Klopfen vorgeschlagen hat, nach dem der zentrale Taktgeberpuls die allgemeine Untergliederung des erzeugten Rhythmus ist. Stattdessen schlagen sie einen inneren Zeitmesser vor, der der Länge eines der Pulse auf der Tactus-Ebene entspricht. In dem oben dargestellten Modell tritt die Untergliederung des Grundpulses nur auf, wenn es notwendig ist. Sie besteht bei Abwesenheit des untergliedernden Materials nicht weiter. Das ist merkwürdig, wenn man bedenkt, dass der oft zitierte Povel (1981) gezeigt hat, dass Leute dazu neigen, Rhythmen im Hinblick auf eine gemeinsame zugrundeliegende Einheit wahrzunehmen und am wenigsten Schwierigkeiten haben, Rhythmen wahrzunehmen, die solch einer Struktur entsprechen.
Die Idee eines zweiten, schnelleren kognitiven Taktgebers scheint wohl einigen Theorien über die Rhythmus-Wahrnehmung entgegenzustehen. Nach Brower verarbeiten wir die Struktur der schnellen (subtactus) Rhythmen in einer mehr qualitativen Weise. Statt einzelne Zeitspannen gegenüber dem Hintergrund eines im Inneren erzeugten metrischen Rasters zu messen, nimmt der Hörer Subpuls-Rhythmen durch ihre Qualitäten an „Gleichmäßigkeit oder Ungleichmäßigkeit, Zwei-heit oder Drei-heit, Akzentuiertheit oder Unakzentuiertheit und so weiter“ wahr (Brower 1993: 25). Sie zitiert Preusser (1972), der einen experimentellen Beweis für einen Unterschied zwischen einer ganzheitlichen, unmittelbaren, passiven Verarbeitung von schnellen rhythmischen Gestalten und einer intellektualisierten, kognitiven, aktiven Verarbeitung von langsameren Rhythmen fand. Sie sagt, dass die Schwankungen beim Spielen (zum Beispiel wird 2:1 zu 1,75:1, wie in Fraisse 1982 beschrieben wurde) ein Beweis dafür sind, dass der schnelle Taktgeber nicht der genaueste für die Musik ist. Browers Behauptung über die Unzuverlässigkeit des schnellen Taktgebers scheint aus der Verallgemeinerung über ungeübtes rhythmisches Verhalten zu stammen.
Meine eigene Erfahrung als Musiker legt hingegen nahe, dass das, was wir als Groove bezeichnen, leichter erreichbar ist, wenn sich die Mitglieder eines Ensembles gemeinsam auf die fortlaufenden kleinen Untergliederungen des Beats konzentrieren, gleichgültig, ob sie mit musikalischen Ereignissen gefüllt sind oder nicht. Genauso lehrt uns C.K. Ladzekpo, die abstrakten, fortlaufenden rhythmischen Untergliederungen als ein ständiges Reservoir für rhythmische Intensität, als eine schnelle, dynamische, unablässige Bewegung zu fühlen, die er „yell“ nennt (Ladzekpo 1995). Die Wahrnehmung dieser kontinuierlichen Aktivität dient dem Musiker dazu, eine einfache rhythmische Figur zu beleben. Das scheint ganz ähnlich zu sein wie bei der „vorgestellten Bewegung“, die wir im Zusammenhang mit der Pulswahrnehmung diskutiert haben, aber nun bei einer schnelleren Frequenz der Pulsunterteilung. Durch das Aufrechterhalten eines Gespürs für diese abstrakten Subpulse und dadurch, dass man sie sich nicht leise, sondern laut vorstellt, steigert der Musiker nicht nur die rhythmische Präzision, sondern erreicht auch Hinweise für die adäquate Dauer und die Intensität der einzelnen Noten.
Entgegen den Behauptungen Browers legen die Unterweisungen Ladzekpos nahe, dass man lernen kann, den schnellen Subpuls zu internalisieren, sodass man sich nicht auf seine körperliche Verstärkung verlassen muss. Das entspricht einem von Ivry (1998) vorgestellten Modell, das eine Reihe von Taktgebern in unserem neuronalen Apparat vorschlägt, wobei jeder auf die Zeitkonstanten unserer verschiedenen Gliedmaßen, Finger und anderen Effektoren bezogen ist und so verschiedene Aufgaben ausführt. Wenn wir in der Lage sind, von den Aktivitäten des Fortbewegungstyps zu einem abstrakten Konzept des musikalischen Pulses zu verallgemeinern, dann ist es genauso möglich, dass wir – mit Übung – lernen können, einen schnelleren Taktgeber zu internalisieren. Letzterer wäre auf die zeitliche Struktur der Bewegung der Finger, Hände und der Zunge bezogen, die (wie ich in Kapitel 3 erwähnt habe) auf einer Zeitskala ablaufen, die wesentlich schneller ist als die Tactus/Fortbewegungsfrequenz.
Sollte das alles zutreffen, dann schiene es, dass - obwohl man zwei gleichzeitige zentrale Taktgeber postulieren kann – die Frequenz des einen ein Vielfaches von der des anderen ist. Wiederum – mit Übung – würde ein Musiker lernen, den schnelleren Taktgeber, der mit der körperlichen Aktivität des Musikmachens assoziiert wird (wie schnelle Fingerbewegung) mit einem langsameren Tactus-Ebene-Puls zusammenzuspannen. Ich betone die Idee des Übens dieses Verhaltens, weil (wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde) Groove-basierte musikalische Aktivität sehr geschickte und präzise zeitliche Schärfe erfordert, weit jenseits von der Einfachheit eines typischen Klopf-Experiments. Bezeichnenderweise ist Groove-basierte musikalische Aktivität naturgemäß auch ausgesprochen körperlich. Sie ist eben nicht eine abstrakte Form von Kenntnissen, sondern auch eine konkrete Fähigkeit, die körperliche Geschicklichkeit erfordert.
Ein dreiteiliges Modell
Bilmes (1993) hat ein dreiteiliges Modell für ausdrucksvolles Timing in Groove-basierter Musik entwickelt. Zusätzlich zum hervorstechenden mittelschnellen Puls oder Tactus wird ein weiterer wichtiger Pulszyklus definiert, der von feinster zeitlicher Auflösung ist – bezogen auf das jeweilige Musikstück. Er wird als zeitliches Atom oder Tatum bezeichnet (in Huldigung des großartigen afro-amerikanischen, improvisierenden Pianisten Art Tatum) und ist die kleinste kognitiv aussagekräftige Untergliederung des Hauptbeats. Mehrere Tatum-Raten können gleichzeitig aktiv sein, besonders in Ensemble-Performances. In der westlichen Notation mögen Tatums typischerweise Sechzehntelnoten oder Triolen entsprechen, obwohl sie im Verlauf einer Performance variieren können. Wie bereits oben erwähnt, wird Groove-basierte Musik teilweise durch konzentrierte Aufmerksamkeit auf Ereignisse auf dieser feinen Ebene charakterisiert. Der Tactus und das Tatum verschaffen zumindest zwei unterschiedliche Taktgeber für die rhythmische Synchronisation und Kommunikation unter Musikern.
In Bilmes Schema weist eine Performance musikalische Phänomene auf, die auf drei Zeitskalen dargestellt werden können. Erstens entspricht der musikalische Referent oder „score“ der grundlegendsten Darstellung der gespielten Musik, wie sie in westlichen Begriffen notiert werden würde, indem quantisierte2) rhythmische Werte (Tatums) verwendet werden, die den Hauptpuls untergliedern. Alle Notenereignisse werden auf dieser Ebene dargestellt. Zweitens werden auf relativ großer Zeitskala Zwischeneinsatzintervalle durch Tempo-Variationen gedehnt und gestaucht. Diese Variation kann als Tempokurve dargestellt werden – eine Funktion der musikalischen Zeit gegenüber der Score-Zeit. Allerdings gibt es (besonders in perkussiver Musik) kein wirkliches musikalisches Kontinuum, das von den Notenereignissen losgelöst ist; Score-Zeit ist quantisiert in Einheiten aus Tatums. Tatsächlich arbeitet die Tempokurve mit Tatums, indem sie deren Dauer so modifiziert, dass ihre sequentielle Summe dem Integral der Tempokurve entspricht. Auf diese Weise kann das Tatum als eine Abtastrate betrachtet werden.
Drittens fängt die Tatum-bezogene zeitliche Deviation (Abweichungsmaß) viele der expressiven Mikrotiming-Variationen ein, die im vorhergehenden Kapitel diskutiert wurden. Deviationen quantifizieren die mikroskopischen Verzögerungen oder Vorwegnahmen von Notenereignissen bezogen auf den theoretischen Tatum-Einsatz. In anderen Worten: Sie stellen den mikroskopischen Wert dar, in dem Noteneinsätze von starrer Quantisierung abweichen – vor einem metronomischen Hintergrund. Deviationen nehmen stufenlose Werte von -0,5 bis +0,5 Tatums an, sodass alle möglichen rhythmischen Platzierungen erlaubt sind. Im Fall mehrfacher gleichzeitiger Tatum-Raten kann dies eine redundante Darstellung ermöglichen, bei der das jeweilige Notenereignis in einer Reihe von verschiedenen Arten beschrieben werden kann. Zum Beispiel können Swing-Noten als abweichende Sechslinge oder als unterschiedlich abweichende Sechzehntelnoten wiedergegeben werden. Wir schließen diese Mehrdeutigkeit absichtlich mit ein, weil solche Mehrdeutigkeiten in der Musik, die wir studieren, häufig und naturgemäß auftreten.
Bilmes verwendete in seiner Arbeit aus 1993 Signalprozesstechniken, um jede dieser drei Quantitäten aus einer musikalischen Performance zu extrahieren. Die Arbeit zeigt, dass die Analyse der Deviationen Licht auf die inneren Repräsentationen der Musiker vom rhythmischen Inhalt ihrer Performances werfen kann, insbesondere in Ensemble-Kontexten, die fixe oder variable rhythmische Gruppierungen aufweisen.
Darstellung & Ausführung [Representation & Implementation]
Wir haben soeben das oben genannte Modell erarbeitet und damit eine leistungsfähige Darstellung von musikalischen Rhythmen entwickelt. Wenn man diese Darstellung in das MAX (eine grafische, objektorientierte Musikprogrammier-Umgebung, Puckette 1991) implementiert, schließt sie Eigenschaften wie Tonhöhe, Akzent, rhythmische Deviationen, Tempo-Variationen, Notendauer (welche wichtige rhythmische Informationen tragen und deshalb unabhängig behandelt werden) und wahrscheinlichkeitstheoretische Prozesse mit ein. Sie kann in Verbindung mit MIDI-Instrumenten, anderen Synthesizern oder Soundmodulen verwendet werden.
Um die Verwendung der Darstellung zu erleichtern, haben wir verschiedene Editoren und Player entwickelt …. Eines unserer Hauptziele war die interaktive Musikperformance [...]
Die grundlegende Einheit unserer Darstellung ist die Zelle [Cell], eine Datenstruktur, die eine Dauer und eine Anzahl von Note-layers [Notenschichten und so weiter] enthält. Der jeweilige Note-layer enthält entweder ein einzelnes, regelmäßiges Tatum-Raster, dessen Elemente Noten enthalten, oder eine verknüpfte Liste von Noten, die an partiellen Punkten der Dauer der Zelle auftreten. [...]
[...]
Modularität
Beachte, dass das Gesamtkonzept eine Hierarchie auf der innerzellulären Ebene bevorzugt und eine „Heterarchie“ oder Modularität auf der multizellulären Ebene. Diese Priorisierung bevorzugt einen modularen [baukastenartigen] Zugang zur Musikorganisation. Wie im Kapitel über Musik und Embodiment dargestellt wurde, hat das modulare Konzept der musikalischen Form besondere Bedeutung für die afrikanischen und afro-amerikanischen Musiken. Zum Beispiel entstehen rhythmische Texturen oft aus der Überlagerung verschiedener zyklischer musikalischer Muster. Ein sehr gutes Beispiel für dieses Merkmal findet sich in der afro-kubanischen Rumba, die feststehende zyklische Clave- und Holzblock-Ostinati, relativ gleichbleibende repetitive Muster auf den tiefen und mittleren Conga-Trommeln und variable, stark improvisierte Quinto-(hohe Conga)-Parts aufweist, wobei alles zusammen eine extrem reich gestaltete Textur ergibt. Dieser modulare Zugang kann auch auf einer höheren hierarchischen Ebene auftreten. Musikstücke können eine Reihe von unterschiedlich wiederholten Abschnitten haben, die beliebig lange zirkulieren. Die Übergänge zwischen diesen Abschnitten werden oft auf improvisierte Art eingesetzt, unter Umständen ganz ohne eine vorherbestimmte großskalige zeitliche Struktur oder eine strikte Vorstellung von der gesamten musikalischen Zeit. Wie bereits früher erwähnt wurde, bietet die Musik von James Brown viele Beispiele dieses Typs. Die aus der Linguistik abgeleitete Auffassung von einer großskaligen rekursiven Tiefe kann hier (für den Musiker oder den Hörer) ersetzt oder ergänzt werden durch ein Konzept der großskaligen organisierten Weite. Wir charakterisieren diese Methode der musikalischen Organisation als modular; große musikalische Strukturen sind zusammengesetzt aus kleinen, eigenständig geformten, konstituierenden Einheiten. Dieses mosaikartige Konzept dient als eine wichtige ästhetische Leitlinie in afrikanischen und afro-amerikanischen Musikarten, wobei sie in vielen unterschiedlichen Manifestationen in den Kulturen dieses Kontinents und ihrer Diaspora auftritt.
In unserer Ausführung können Zellen entweder in Serie oder parallel zu größeren Zellen zusammengefügt werden oder sie können auch unbegrenzt zirkulieren.
[...]
Applikation
Der Reichtum der Kontrolle über viele bedeutende musikalische Quantitäten unterscheidet unsere Darstellung von den allgemeineren Anwendungen, wie Musiknotationsprogrammen, Drum-Maschinen [...]
8. Schlussfolgerungen für die Musikwahrnehmung, die Musikwissenschaft und die Computermusik
Meine umfassende These ist, dass die Musikwahrnehmung und Kognition verkörperte Aktivitäten sind, die in hohem Maß von den Eigenschaften unseres sensomotorischen Apparates und auch vom soziokulturellen Umfeld abhängen, in dem die Musikwahrnehmung, Kognition und Produktion stattfinden. Ich habe einige spezifische Hinweise für die Unterstützung dieser These präsentiert, indem ich gezeigt habe, wie gewisse Rhythmen afro-amerikanischer Musik auf solche verkörperten Prozesse bezogen sein können. Ich habe behauptet, dass die Musikwahrnehmung und Kognition mehr aktive Konstruktionen als passive Erfahrungen des Hörers sind. Vor allem sind die Wahrnehmungen des Pulses und des Metrums keine Zwangsläufigkeiten, sondern Hörstrategien, die stark von der Person und dem kulturellen Hintergrund der Person abhängen. Ich habe auch argumentiert, dass vieles von dem, was wir beim Hören von aufgeführter Musik erfahren, sich auf eine ökologische Erkennung der Körperbewegung bezieht, aus der die musikalischen Klänge resultieren, – und sogar auf eine Einfühlung in diese Körperbewegung. Diese klanglichen Spuren der Körperbewegung können als solche angesehen und in gewissen Kulturen sogar ästhetisch bevorzugt werden, während sie in anderen negiert oder unterdrückt werden.
Die Musikkognitionsforschung war ein bisschen langsam bei der vollen Anerkennung der Rolle der Kultur bei der Gestaltung unserer Arten der Musikwahrnehmung. Beachte die Suche nach dem Universellen in der menschlichen Musikkognition. In einem kürzlichen, ziemlich kontroversiellen und fehlerhaften Vortrag über mögliche evolutionäre Erklärungen für die Existenz von Musik (eingeleitet mit der Aussage: „Ich verstehe nichts von Musik, aber …“) machte der Evolutionsbiologe Steven Pinker eine bezwingende Behauptung: Wenn wir die Grundlagen der Musikkognition studieren wollen, sollten wir uns mehr auf die Musikerfahrungen der Massen beziehen (wie Hip-Hop, den Eurovisionskontest, Disco und so weiter) als auf die Kunstmusik der Hochkultur (Pinker 1997). Ich stimme dieser Behauptung zu, bestreite aber seine späteren Annahmen, dass die Wahrnehmung und Kognition der Musik ein überwiegend alleiniger, nachdenklicher Akt ist. Sein Modellhörer war ein idealisierter, radikal desituierter – mit Kopfhörern und geschlossenen Augen, in Wahrheit eine Heraufbeschwörung des klassischen westlichen autonomen Hörers, wie er in vielen europäischen musiktheoretischen Texten (zurück bis zu Plato) beschrieben wird – wie McClary (1991) aufgezeigt hat (siehe unten). Als Pinker gefragt wurde, ob er eine Vorstellung habe, wie Gruppenpsychologie auf die Evolution der Musik eingewirkt haben mag, entgegnete er: Wenn solche Effekte existiert haben sollten, so seien sie absolut zweitrangig gewesen. Es ist klar, dass Musikhören das kognitive System eines Individuums involviert. Aber man kann das Gleiche von der Sprachfähigkeit sagen. Niemand würde behaupten, dass die Sprache – vor allem die gesprochene Sprache – deshalb einer alleinigen, nachdenklichen Aktivität dient. Sprache dient als Mittel der interpersonellen Kommunikation, und zwar nicht bloß zur Information über Fakten, sondern auch über Emotionen, Zusammenhänge und Vorstellungen. Man kann sagen, dass dasselbe für Musik gilt. Tatsächlich sind die Verbindungen zwischen Musik und Sprache ausgesprochen weitreichend, wie ich weiter unten diskutieren werde.
Im selben Vortrag argumentierte Pinker, dass die Musik als eine „Vergnügungstechnologie“ betrachtet werden kann – eine konzentrierte Dosis von auditiven Mustern, die sich ereignen, um für andere evolutionäre Gründe Vergnügen zu bereiten. Zum Beispiel verleihen sensorische Systeme ein Gefühl von Vergnügen, wenn sie einen optimalen Input empfangen – klare, analysierbare Signale – vielleicht weil solche Signale evolutionär bevorzugt wurden. Deshalb mag man die Hypothese aufstellen, dass einfach organisiertes musikalisches Material populärer sein würde als Stücke mit großer Oberflächenkomplexität. Aber das ist bei vielen populären Musiken nicht der Fall. Salsa und afro-kubanische Rumba (CD-37) würden von kulturell Außenstehenden als ausgesprochen komplex beurteilt werden. Es scheint, dass das Einfachheitskriterium eines von vielen konkurrierenden Kriterien in der Wahrnehmung einer Musik als vergnüglich oder nicht sein kann. Man kann auch an andere Funktionen von Musik denken, die nicht eindeutig von Vergnügen abgeleitet sind. Beachte zum Beispiel einen musikalischen Merkspruch wie den Alphabet Song, den nahezu alle kleinen englischsprachigen Kinder lernen. Er hilft beim Merken einer großen Zahl von Symbolen, indem er sie mit einer vertrauten Melodie verbindet (der von Twinkle, Twinkle Little Star) und in sechs Stücke von zunehmender Größe teilt. Tanzmusik bildet ein weiteres Beispiel: Nicht jede Tanzmusik ist überwiegend auf Vergnügen bezogen (wie in vielen religiösen, rituellen und erzählenden Tanzformen); aber viele soziale Situationen, die Tanz einbeziehen, scheinen die kollektive Einheit zu bestärken, welche selbst das Vergnügen verstärken kann.
Nur jemand, der nichts von Musik versteht, kann die hässlichen Schlussfolgerungen von Pinkers Anregungen übersehen, die Beispiele von „Quasi-Musik“ zu studieren, zu denen er in herablassender Weise Rap-Musik neben Zug-Pfeifen und Holzfällen zählt. Blacking warnt vor dieser „evolutionären“ Behandlung der Entwicklung von musikalischen Stilen (Blacking 1973: 55-56). Solch einen Mangel in der Beschreibung und im Verständnis gibt es hinsichtlich der Musik so vieler Kulturen, dass es unmöglich ist, irgendeine Musik als primitiv zu verurteilen. Oft erscheint ein musikalischer Stil für eine Kultur als simpel, weil er nach falschen Kriterien beurteilt wird. Wir sehen das in unserer eigenen Kultur: Nach anderen musikalischen Standards ist Hip-Hop-Musik musikalisch sekundär und schal, weil sie (zum Beispiel) nicht genug Akkordwechsel oder Melodien hat. Ich brauch nicht herauszustreichen, dass die Hip-Hop-Kultur ihre eigenen hoch entwickelten, charakteristischen und ausgeklügelten Ästhetiken und Standards hat, auch nicht, dass sie hoch entwickelte improvisatorische Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen erfordert: vokal, instrumental (Turntables) und im Tanz. Man muss hervorheben, dass Pinkers ethnozentrischer Kommentar und seine Argumente im Allgemeinen seine Ignoranz für diese Dimensionen verraten. Dieses Beispiel ist bezeichnend für eines der größeren Probleme in diesem Bereich, nämlich für die Tendenz, aus einer Armut der Daten Verallgemeinerungen zu schließen, gewisse Verschiedenheiten der musikalischen Komplexität zu fetischisieren und blind zu bleiben für nicht-europäische Parameter des musikalischen Ausdrucks.
Jedenfalls verweisen Fragen der Komplexität (im Hip-Hop genauso wie in fast allen anderen Fällen der Musik und der Sprache) auf Fragen der Funktion und der Nützlichkeit. Tatsächlich hebt Pinker in seinem eigenen Buch The Language Instinct (1994) hervor, dass alle menschlichen Sprachen so ziemlich den gleichen Grad an Komplexität haben. Sie erscheinen als völlig ausgeformt, unabhängig von einem kulturellen oder technischen Stand. Pinker lehnt die berühmt-berüchtigte Sapir-Whorf „Relativismus“-Hypothese (Whorf 1956) entschieden ab, die behauptete, dass Sprache und Kultur sich gegenseitig in jenem Grad gestalten, wie gewisse kognitive Fähigkeiten, wie Farbklassifizierung, durch Faktoren der Kultur und des Umfeldes erweitert oder verkrüppelt werden. Stattdessen argumentiert Pinker, dass Menschen mit einer Grundausstattung an fest verdrahteten kognitiven Kapazitäten, zu denen die Sprache zählt, geboren werden. Auf diese Weise leitet Pinker seine Ideen von Chomsky (siehe zum Beispiel Chomsky 1975) ab, und zwar vor allem aus Chomskys Erkenntnissen von Universalitäten oder „Superregeln“ der menschlichen Sprache. Zum Beispiel zitiert er Daten, die zeigen, dass Kinder fähig sind, die erforderliche Komplexität einer vollständigen Sprache hervorzubringen, wie einer kreolischen Sprache oder amerikanischen Zeichensprache, selbst wenn ihre Eltern ein Kauderwelsch oder eine schäbige Version von Zeichensprache sprechen. Vielleicht können wir die Hypothese aufstellen, dass Musik eine ähnliche Grundausstattung von Komplexität und ein ähnliches Set aus Superregeln enthält, das zwischen rhythmischen, melodischen und anderen Komponenten verteilt ist. Pinker behauptete in seiner Rede jedoch, dass Musik über die Kulturen hinweg extreme Variationen in der Komplexität zeige, wobei tonale Musik eine Art Spitze darstelle (Pinker 1997). Es ist davor zu warnen, der musikalischen Komplexität zu viel Bedeutung beizumessen:
Das Thema der musikalischen Komplexität ist in der Betrachtung der allgemeinen musikalischen Kompetenz irrelevant. Erstens kann in einem einzelnen musikalischen System eine größere Oberflächenkomplexität wie eine Erweiterung des Vokabulars sein, die die grundlegenden Prinzipien einer Grammatik nicht verändert und die bei einer Abtrennung von diesen Prinzipien bedeutungslos werden würde. Zweitens können wir beim Vergleich verschiedener Systeme nicht unterstellen, dass Oberflächenkomplexität entweder musikalisch oder kognitiv komplexer ist. Der menschliche Geist ist jedenfalls unendlich komplexer als alles, was von einzelnen Menschen oder Kulturen hervorgebracht wird. (Blacking 1973: 34-35).
Weiters zeigt die von Dowling (1988) besprochene Forschung, dass sehr kleine Kinder spontane Lieder hervorbringen, die aber keineswegs imitierende Elemente der Produktionen von Erwachsenen enthalten. Genau wie in der Sprachentwicklung scheint die Liedentwicklung durch eine Reihe von festgelegten, von Regeln geleiteten Stufen zu führen, die einigermaßen unabhängig vom externen Input sind. Die rohen Materialien für diese kognitiven Prozesse treten jedoch (wie bei der Sprache) nicht in einem Vakuum auf. Das Kind braucht gewisse grundlegende Stimulationen, um diese Kapazitäten zu entfalten. Es sieht so aus, als würde eine fest verdrahtete Grundlinie des musikalischen Verstehens existieren; diese grundlegende kognitive Fähigkeit kann jedoch verkümmern, wenn sie nicht in jungen Jahren ausreichend gefördert wird – so wie es auch bei der Sprache der Fall ist.
Signalisieren Variationen in der Oberflächenkomplexität Variationen in der fundamentalen Struktur? Oder gibt es da andere Faktoren? Zum Beispiel kann extreme Oberflächenkomplexität als eine Art von Exklusivität dienen, so wie eine extrem jargonartige Sprache eine bestimmte kleine professionelle Gemeinschaft abgrenzt. Läuft eine gesteigerte Komplexität mehr auf eine Art von erweitertem Vokabular hinaus als auf eine kompliziertere Grammatik? Eine allgemeine musikalische Grammatik enthält etwa sowohl interpersonelle als auch individuelle Faktoren; höchstwahrscheinlich enthält sie das konzeptuelle Gerüst für Embodiment, Tanz und kollektives rhythmisches Synchronisieren genauso wie Regeln für die Steuerung der melodischen und rhythmischen Struktur. Wenn wir dieser Betrachtungsweise folgen, können wir die Möglichkeit, dass eine universale musikalische Kompetenz besteht, in Betracht ziehen und auch die Frage, wie sie sich manifestieren kann.
Schließlich müssen wir jedoch die Zweckmäßigkeit eines Konzeptes von musikalischen Universalien hinterfragen. Obwohl von Brown (1991) (durch gründliche und sorgfältige Analysen von so vielen dokumentierten Ethnografien wie nur möglich) belegt wurde, dass jede bekannte Kultur Musik und Tanz hat (sodass sie selbst menschliche Universalien sind), sollten wir hinsichtlich der Grenzen der Behauptung, dass dieselben Prinzipien allen Musikarten der Welt zugrunde liegen, vorsichtig sein. Was auch immer die Funktion der musikalischen Universalien sein mag, die Besonderheiten scheinen genauso bedeutend zu sein. Zum Beispiel legen kulturübergreifende Studien nahe, dass Hörer große Schwierigkeiten haben, den emotionalen Gehalt der Musik einer anderen Kultur, mit der man nicht vertraut ist, intuitiv zu erfassen (Gregory & Varney 1996). Weiters können sich sogar Leute „derselben“ Kultur beim Entschlüsseln des emotionalen Inhalts eines Stückes auf dieselbe Weise irren. Musikalische Darstellungen von Ausgelassenheit und Wut können oberflächlich oft ähnliche Eigenschaften haben; zum Beispiel haben solche Ähnlichkeiten zu vielfach umstrittenen Interpretationen der Musik von John Coltrane geführt, die abwechselnd als zornig oder freudvoll angesehen wurde (CD-53). Ähnlich können die musikalischen Beschreibungen von Sexualität und Gewalt wechselweise missdeutet werden (Wessel 1998). Daher scheint eine der am wenigsten bestreitbaren Dauerhaftigkeiten der Musik, nämlich ihre Fähigkeit zu emotionalem Ausdruck, mehr das Resultat kultureller Assoziationen zu sein als rein innermusikalischer Dynamiken. Genauso wie unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Wörter für Lust und Leid haben, so können sie auch unterschiedliche klangliche Gesten für emotionale Bedeutungen haben. Die kulturellen Faktoren, die zu musikalischen Aktivitäten führen, bringen den Reichtum hervor, der eine Musik von einer anderen unterscheidet, und das machen sie in einer ergiebigen, nicht begrenzenden Weise.
Ich werde nun kurz auf die Auswirkungen dieser These auf den Bereich der Computermusik eingehen.
[...]
Ein gegenwärtiger Song, der den Sound des TR-808 (CD-54) benutzt, spielt in Form von Signifyin’ zwangsläufig auf die Vergangenheit an.
[...]
Die strategische Verwendung von roboterartigen Rhythmen kann ein entkörperlichtes, techno-fetischistisches, futuristisches Ideal suggerieren (wie in der gegenwärtigen Electronica) oder es kann einen Signifyin’-Refrain auf Technologie, Geschichte und Erinnerung verkörpern (wie im gegenwärtigen Hip-Hop, der sich auf Sounds seiner Anfänge bezieht (CD-54)).
Oft spielt populäre Computermusik im Graubereich zwischen körperlicher Präsenz und elektronischer Unmöglichkeit. Wiederum zeigt ein Beispiel aus der Electronica diese spielerische Doppeldeutigkeit (CD-55).
[...]
Ein anderes vorzügliches Beispiel für das Spiel mit dem Embodiment in der gegenwärtigen Popularmusik ist der Hip-Hop-DJ, der die Turntables als eine Art Meta-Perkussionsinstrument bedient (CD-56).
[...]
Das Spiel mit der Doppeldeutigkeit des Embodiments tritt auch in manchen mehr experimentellen Bereichen der Computermusik auf. Die improvisierende Koto-Spielerin Miya Masaoka (CD-57) erweitert die physischen Kapazitäten ihres hölzernen Saiteninstruments mit elektronischen Sensoren, die eine Reihe von Synthesizern und Samplern antreiben.
[...]
Im Bereich empfindlicher, ausdrucksvoller Steuergeräte hat David Wessel (CD-58) ein produktives Rahmenwerk für die Improvisation entwickelt – mit dem Buchla Thunder, einem neuartigen elektronischen Instrument mit zwei Dimensionen stufenloser Regelung (Position und Druck) für jede Fingerspitze.
[...]
Unter einem etwas anderen Paradigma hat der improvisierende Posaunist George Lewis (CD-59) ein Computerprogramm aufgebaut, das mehrstimmig improvisiert – mit anderen Musikern oder ohne sie.
[...]
Popdiva Madonna sagt, sie wollte bei ihrem letzten Electronica-Album die Möglichkeiten erkunden, dem typischerweise unmenschlichen Sound dieser Musikart „eine Seele“ zu geben (Rule 1998). Ihre Lösung war tief empfundene (wenn auch äußerst banale) Texte, wiedergegeben von der sofort erkennbaren Stimme einer Berühmtheit (CD-60). Aber jetzt, wo wir angefangen haben, die gegenwärtige Spur des menschlichen Körpers im mikro-rhythmischen Inhalt der instrumentalen Musik zu analysieren, können wir vielleicht das beharrliche Klischee hinterfragen, dass elektronische Musik es verfehlt, ein Gefühl von Soul zu vermitteln. Wofür gibt es Soul in der Musik, wenn nicht für eine starke körperliche menschliche Präsenz? (CD-61).
Zurück zu Groove-Theorien
——————————————————
Fußnoten können direkt im Artikel angeklickt werden.